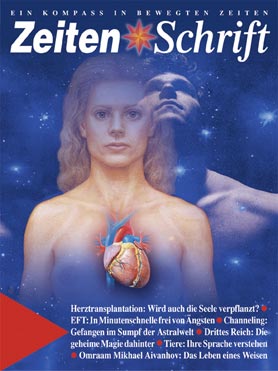Friedensdorf: Eine Oase des Friedens
Mitten im Herzen Israels gibt es ein Dorf, das Hoffnung bedeutet für den krisengeplagten Nahen Osten. Seit Jahren leben dort Juden und Palästinenser in Frieden und gleichberechtigt zusammen.
Es war im Jahr 1967, als der französische Priester Bruno Hussar sich entschloß, seinen Traum zu verwirklichen: Die Gründung des Friedensdorfes Neve Shalom/Wahat al-Salam in Israel. Der Name des Ortes, eine Verbindung des Hebräischen und Arabischen, bedeutet „Oase des Friedens“ oder „Quelle des Friedens“. Der Geistliche hatte die Schaffung eines Dorfes im Sinn, das Juden, Muslime und Christen vereint. Ein Dorf, in welchem die Angehörigen der drei großen abendländischen Weltreligionen gemeinsam leben, in welchem sie ihrem jeweiligen Glauben und ihren Traditionen treu bleiben und gleichzeitig Glaube und Traditionen des anderen voll respektieren und in dieser Verschiedenheit eine Quelle der persönlichen Bereicherung finden. Ein wahrhaft hohes Ziel, wenn man weiß, daß Jerusalem und sein Umland seit Jahrhunderten aus einem Mosaik von religiösen, nationalen und kulturellen Gemeinschaften besteht, die alle entweder in völliger Gleichgültigkeit füreinander leben oder untereinander durch Streitigkeiten und Kriege verfeindet sind.
 In seiner Autobiographie schreibt Bruno Hussar: „Der Traum von Neve Shalom, den einige von der Situation besonders betroffene Personen mit mir teilten, ist der Überzeugung entsprungen, daß etwas getan werden muß. Zusammen mit Gleichgesinnten wollten wir diese Situation ändern und für Versöhnung und Frieden in Israel arbeiten. Später, so Gott will, könnte sich diese Bemühung über die Grenzen unseres Landes hinaus ausdehnen.“ Und weiter: „Wir wollten prüfen, ob ein geschwisterliches Zusammenleben in Achtung vor dem Anderssein der anderen möglich sei, und dann, war diese Probe bestanden, den Rahmen für eine „Schule des Friedens“ bilden. In den verschiedenen Ländern gibt es Akademien, auf denen man jahrelang die Kriegskunst erlernt. Gemäß dem prophetischen Wort: „Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt sich nicht mehr für den Krieg.“ [Jes 2,4 und Mi 4,3], wollten wir eine „Friedensschule“ errichten, denn auch der Frieden ist eine Kunst: Er entsteht nicht improvisiert, sondern muß gelernt werden.“
In seiner Autobiographie schreibt Bruno Hussar: „Der Traum von Neve Shalom, den einige von der Situation besonders betroffene Personen mit mir teilten, ist der Überzeugung entsprungen, daß etwas getan werden muß. Zusammen mit Gleichgesinnten wollten wir diese Situation ändern und für Versöhnung und Frieden in Israel arbeiten. Später, so Gott will, könnte sich diese Bemühung über die Grenzen unseres Landes hinaus ausdehnen.“ Und weiter: „Wir wollten prüfen, ob ein geschwisterliches Zusammenleben in Achtung vor dem Anderssein der anderen möglich sei, und dann, war diese Probe bestanden, den Rahmen für eine „Schule des Friedens“ bilden. In den verschiedenen Ländern gibt es Akademien, auf denen man jahrelang die Kriegskunst erlernt. Gemäß dem prophetischen Wort: „Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt sich nicht mehr für den Krieg.“ [Jes 2,4 und Mi 4,3], wollten wir eine „Friedensschule“ errichten, denn auch der Frieden ist eine Kunst: Er entsteht nicht improvisiert, sondern muß gelernt werden.“
„Aus dem ganzen Land würden die Menschen kommen, um dort dem „Anderen“ zu begegnen, mit dem Wunsch, die Mauern der Angst, des Mißtrauens, des Unwissens, der Verständnislosigkeit, der Vorurteile – alles trennende Dinge – einzureißen und Brücken des Vertrauens, des Respekts, des gegenseitigen Verständnisses und, wenn möglich, der Freundschaft zu errichten. Dieses Ziel würde durch Seminare, Techniken der Gruppenpsychologie, gemeinsame körperliche Arbeit und Freizeitabende erreicht werden.“
Vier Seelen wohnen in seiner Brust
Die kosmopolitische Geburtsurkunde des Priesters zeichnet seinen Weg hin zur Universalität vor. Bruno Hussar, ein Jude italienischer Abstammung mit französischer Nationalität, wird 1911 in Ägypten geboren. In Frankreich, wo er ein Ingenieurstudium absolviert, konvertiert er zum Katholizismus und begeistert sich für Theologie. Er besucht das Priesterseminar und wendet sich dem Predigerorden der Dominikaner zu. Die Dominikaner, die für unkonventionelle und dem Katholizismus fremde Denkansätze offen sind, bieten Bruno Hussar die Möglichkeit, die jüdischen Grundlagen des Christentums zu studieren. Dieses Thema fasziniert ihn, weil er sich so mit seinen eigenen Wurzeln beschäftigen kann. Da es seiner Arbeit förderlich scheint, geht er nach der Unabhängigkeit nach Israel und läßt sich schließlich dort nieder. Er sagt über sich selbst: „Ich bin katholischer Priester, ich bin Jude; ich bin israelischer Staatsbürger, in Ägypten geboren, wo ich achtzehn Jahre lang gelebt habe: Ich spüre in mir vier verschiedene Identitäten: Ich bin wirklich Christ und Priester, ich bin wirklich Jude, ich bin wirklich Israeli, und wenn ich mich auch nicht als Ägypter fühle, so stehe ich den Arabern, die ich kenne und liebe, doch sehr nahe.“
Sein Traum von Neve Shalom/Wahat al-Salam wird zur fixen Idee, und Bruno Hussar beginnt nach einem Ort zu suchen, wo er ihn verwirklichen kann. Doch wie findet man ein Grundstück, wenn man weder Geld noch Einfluß hat? Nach ergebnislosen Bemühungen und vielen Rückschlägen fällt dem Priester schließlich völlig unvermutet ein Grundstück von vierzig Hektar „vom Himmel in die Hände“. Französische Trappistenmönche zeigen sich bereit, ihm für seine Idee einige Hektar Brachland neben dem Kloster für eine symbolische Summe zu vermieten. Der erste Schritt ist getan, das beruhigt und überzeugt den Geistlichen, daß er auf dem richtigen Weg ist. Doch nun muß er eine Ansiedlung in dieser Mondlandschaft errichten. Pater Hussar weiß nicht genau, wie er anfangen soll, und vertraut sich Gott an, um eine Lösung zu finden.
Doch angesichts der unsicheren militärischen und politischen Situation nach dem Sechs-Tage-Krieg muß er seine Vision für lange Monate auf Eis legen. Sobald sich das Klima ein wenig beruhigt hat, greift er erneut zum Pilgerstab und sucht nach Freiwilligen, Juden und Arabern, die verrückt genug sind, sich in ein solches Abenteuer zu stürzen. Er findet keine. Nur einige Freiwillige aus verschiedenen Ländern der Welt kommen und bleiben jeweils für ein paar Wochen.
Ein schwerer Fehlschlag. Fast zehn Jahre lang klopft der Dominikaner an alle Türen, engagiert sich, erklärt, beweist, hofft, und erntet nichts als Gleichgültigkeit. Sein Plan scheint allen utopisch, nur er selbst glaubt daran. Trotz seiner Kraft und der tiefen Überzeugung, die ihm innewohnt, scheint keinem Menschen etwas an Neve Shalom/Wahat al-Salam zu liegen, nicht einmal dem lieben Gott.
Das allgemeine Desinteresse wird schließlich bedrückend, und Ende 1976 ist der Priester, der in dem einzigen spartanischen Haus wohnt, das er auf seinem Land hat bauen lassen, kurz davor aufzugeben. Er hadert mit Gott und stellt ihm ein Ultimatum: „Herr, wenn Du mich fallen läßt, höre ich auf. Zehn Jahre unfruchtbaren und einsamen Kampfes, mehr kann ich nicht tun. Aber wenn ich aufgebe, trägst du ausnahmsweise eine schwere Verantwortung gegenüber den Menschen.“
Das Projekt nimmt Gestalt an
Einige Tage nachdem er mit seinem priesterlichen Streik gedroht hat, lernt Bruno Hussar bei einer Konferenz in Jerusalem die Vertreter einer Vereinigung kennen, von der er schon gehört hat: Beth Hillel/Hillelhaus. Die jungen Anhänger dieser Bewegung, die sich darum bemüht, Juden und Araber bei gemeinsamen Aktivitäten zusammenzuführen, lauschen aufmerksam den Ausführungen des Priesters und ergreifen nicht die Flucht, als er vom Plan eines gemeinschaftlichen Dorfes spricht. Ein junger Mann unterbricht ihn: „Könnten wir Ihr Land für einige Tage mieten?“ Denn die Organisation Beth Hillel plant zusammen mit einer anderen Organisation, Shutafut, welche dieselben Ziele verfolgt, ein internationales Lager mit jungen Arabern und jungen Juden zu organisieren. Doch noch haben sie keinen Ort, um eine solche Veranstaltung abzuhalten. „Warum nicht bei Ihnen in Neve Shalom/Wahat al-Salam?“, fragt der junge Mann. Bei diesen Worten begreift Bruno Hussar, daß Gott ihn zur Ordnung ruft, und entschuldigt sich demütig für seine drängende Ungeduld. Eilig versichert er: „Aber natürlich, das Grundstück steht Ihnen zur Verfügung, wann Sie wollen, Sie sind willkommen. Aber ich muß Sie warnen, es handelt sich wirklich um ein Gelände, das keinerlei Komfort bietet. Wenn Sie Interesse haben, vergessen Sie nicht, die Teilnehmer davon in Kenntnis zu setzen.“
Einige Wochen später verschicken die beiden Organisationen ihre ersten Einladungen: „Ein Treffen in Neve Shalom/Wahat al-Salam“. Als Pater Hussar das frisch gedruckte Programm in Händen hält, ist er gerührt. Er wird gewinnen, jetzt ist er sich ganz sicher. Zum ersten Mal gibt es sein Dorf, der Name wird erwähnt, er ist gedruckt, die Leute werden nach dem Weg fragen!
Das Jugend-Lager hat viel Gutes. So gelingt es Juden und Arabern, zehn Tage lang zusammenzuleben, ohne daß es zu irgendwelchen Zwischenfällen oder Streitigkeiten kommt. Außerdem bildet sich eine Gruppe von etwa zwanzig Personen, die beschließen, über das Anliegen von Pater Hussar nachzudenken, und die sich sogar vorstellen können, vielleicht zusammenzuleben.
Zwei Kulturen, ein Schicksal
Eine Lagerteilnehmerin ist Evi Guggenheim, eine Jüdin aus der Schweiz, die mit 19 Jahren nach Israel ausgewandert war. Sie wird schon bald eine der ersten Dorfbewohnerinnen von Neve Shalom/Wahat al-Salam sein.
Evi wuchs in einer religiösen Familie auf, einer Familie, welche sehr unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten hatte. Die Arztpraxis ihres Großvaters wurde von den Nationalsozialisten enteignet; die Familie floh in die Schweiz. Hier wächst Evi auf, von ihren Eltern sorgsam abgeschottet von der schweizerischen Gesellschaft – um sie vor dem Schmerz zu bewahren, eines Tages ausgeschlossen zu werden. Die schrecklichen Geschichten, die ihre Eltern ihr und ihrem Bruder vom Zweiten Weltkrieg erzählen, versetzen Evi in Angst. In ihrem Buch Oase des Friedens schreibt sie: „Ich wuchs im Bewußtsein meiner Zugehörigkeit zu einer Parallelwelt auf, denn mein Weg wurde immer schmaler, mein Horizont immer enger und der Kreis meiner Freunde zwangsläufig immer eingeschränkter, da mich meine Mutter seit jeher zu jüdischen Institutionen und Organisationen schickte.“ Als Teenager will sich Evi deshalb vom schweren Joch ihrer Familie befreien, sich lösen vom religiösen Judaismus. Sie will nicht länger als Minderheit in der Schweiz leben und beschließt deshalb, nach Israel auszuwandern.
In ihrer neuen Heimat macht Evi Guggenheim eines Tages die überraschende Entdeckung, daß es hier auch Araber gibt, Palästinenser, die auf israelischem Boden leben: „Ich bin nach Israel gekommen, um nicht länger in einer Minderheit zu ersticken, und jetzt stoße ich auf dasselbe Problem – mit dem kleinen Unterschied, daß ich nicht mehr im Lager der Unterdrückten bin, sondern in dem der Unterdrücker.“ Sie wird zornig auf all diejenigen, die ihr Israel als jüdisches Land präsentiert, ihr ein verzerrtes und sehr tendenziöses Bild von der Realität vermittelt haben und nicht erwähnten, daß auch Araber hier leben und daß diese nicht unbedingt glücklich sind. Sie schließt sich deshalb der Friedensbewegung an, um zu einem friedlichen Zusammenleben der beiden Völker beizutragen.
Einer der ersten Dorfbewohner von Neve Shalom/Wahat al-Salam ist auch der junge Palästinenser Eyas Shbeta. Seine Familie erlitt unter den Israelis ein ähnliches Schicksal wie jene von Evi unter den Nazis: Ihr Haus wurde enteignet, die Familie aus dem Dorf vertrieben. Das ganze Dorf wurde dem Erboden gleichgemacht – ein Dorf von dreihundertfünfzig Dörfern, das nach der offiziellen Ausrufung des israelischen Staates innerhalb von wenigen Wochen von der Landkarte getilgt wurde. Eyas erinnert sich an seine Jugendzeit: „Als ich klein war und Verwandte verbotenerweise bei uns übernachteten, war ich immer gewaltig auf der Hut, vor lauter Angst, israelische Soldaten könnten das Haus durchsuchen. Wir lernten zu schlafen wie die Katzen, um nicht im Schlaf überrascht zu werden... Das Klima ständigen Argwohns, die ständige Angst, bespitzelt zu werden, war im Alltag schwer zu ertragen.“ Es ist dieses ständige Mißtrauen, das seiner Ansicht nach die arabische Gesellschaft verdirbt und sie daran hindert, sich zu entwickeln und in aller Ruhe zu entfalten. Eyas hat Glück: Sein Vater ist Lehrer, er kann die Schule besuchen und bekommt später sogar einen der für Palästinenser streng begrenzten Studienplätze an der Universität in Jerusalem. Auf der Universität kommt Eyas in Kontakt mit der Friedensbewegung. Ein palästinensischer Freund nimmt ihn eines Tages mit zu einem Treffen in Neve Shalom/Wahat al-Salam (NSH/WAS).1
Liebe überwindet alle Grenzen
Es ist Liebe auf den ersten Blick, als sich Eyas Shbeta und Evi Guggenheim im Friedensdorf zum ersten Mal begegnen. Für die beiden beginnt ein schwerer innerer Kampf: Kann eine Jüdin einen Palästinenser, ein Palästinenser eine Jüdin lieben? Die Freundschaft und späteren Heiratsabsichten der jungen Leute stellen sie vor schier unüberwindbare familiäre, kulturelle und religiöse Hindernisse. Sie werden hin- und hergerissen zwischen den Gefühlen wahrer Liebe, die sie füreinander empfinden, und dem nagenden Zweifel an der Richtigkeit ihrer Verbindung. Als die beiden zum Beispiel eines Tages beschließen, ins Kino zu gehen, will Evi nicht, daß sie im jüdischen Viertel zusammen mit einem Araber gesehen wird. So geht sie auf der Straße mehrere Schritte hinter Eyas her, und im Kino will sie nicht, daß er mit ihr spricht, obwohl sie weiß, daß er sich schrecklich gedemütigt fühlen muß. „Mir ist klar, daß mir allein meine jüdische Kultur diese Diskriminierung diktiert, die ich immer weniger zu definieren wage, so sehr kommt sie den mir verhaßten Prinzipien nahe...“, gibt Evi preis. Die Hochzeitspläne drohen am seit alters her überlieferten Verbot des Zusammenlebens der beiden Völker zu scheitern. Besonders für die Familie von Evi sind die Heiratsabsichten eine Katastrophe. Denn wenn Kinder aus sehr religiösen jüdischen Familien Nichtjuden heiraten, betrachtet man sie als tot und trauert um sie; man nennt das „Schiwah“. Evi's Eltern lassen deshalb nichts unversucht, um ihre Tochter von dieser für sie unmöglichen Beziehung abzubringen. Und so fragt sich das junge Paar zu Recht, was denn aus ihm werden soll in diesem Umfeld von Haß und Unverständnis.
 Doch schließlich entscheiden sich die beiden, daß sie ihr Glück nicht den Prinzipien anderer opfern, sich nicht dem Diktat ihrer Familien beugen wollen. Am 6. Oktober 1988 heiratet Evi Guggenheim in Zürich Eyas Shbeta.
Doch schließlich entscheiden sich die beiden, daß sie ihr Glück nicht den Prinzipien anderer opfern, sich nicht dem Diktat ihrer Familien beugen wollen. Am 6. Oktober 1988 heiratet Evi Guggenheim in Zürich Eyas Shbeta.
Das junge Paar will seine gemeinsame Zukunft im Friedensdorf aufbauen. Zusammen mit einer Handvoll anderen Paaren (jedoch keine gemischt jüdisch/palästinensischen) gehören sie zu den Mitbegründern des Dorfes. Dem ursprünglichen Projekt von Pater Hussar wird zu jener Zeit eine neue Richtung gegeben: Wichtig ist für die Pioniere, daß Araber und Juden zusammenleben. Der religiöse Aspekt ist nebensächlich. Im Vordergrund soll die Gerechtigkeit stehen, das heißt der Respekt vor den Rechten eines jeden.
Langsam entwickelt sich das Dorf und nimmt Gestalt an. Evi Guggenheim und Eyas Shbeta erinnern sich in ihrem gemeinsamen Buch Oase des Friedens: „Die erste Zeit war hart für uns. Sehr hart. Materiell gesehen waren unsere Bedingungen entsetzlich. Unser täglicher Kampf richtete sich nicht nur gegen die Steine und die pure Not, sondern auch gegen Institutionen, Unverständnis und Dogmatismus auf beiden Seiten. Unser Glaube an die Zukunft aber war unerschütterlich.“ Wasser wurde mit einer dorfeigenen Pumpe auf den Hügel gefördert; für die Stromversorgung gab es nur einen „asthmatischen Generator“. Doch waren die Pioniere erfüllt von der Begeisterung, die Geschichte ihres Landes zu verändern.
Bei jeder Vollversammlung der wenigen Dorfbewohner ging es um die nötigsten Einrichtungen: Anschluß ans Wasser- und Stromnetz und an die Müllabfuhr, Bau einer Asphaltstraße... „Das Problem ist, daß all das teuer ist und daß wir nur von unserem eigenen Geld und einigen Spendern leben. Der Staat Israel gewährt uns keine Subventionen“, schreibt Evi Guggenheim. Menachem Begin hat persönlich auf einen der Subventionsanträge geantwortet, daß es gegen das Gesetz wäre, dem Dorf öffentliche Mittel zu gewähren, solange es auf dem Grund eines Klosters lebt: „Wenn Ihr Dorf aber nach Galiläa ziehen und sich auf einer der freien Flächen, die wir dort anbieten, ansiedeln würde, käme es sofort in den Genuß aller gesetzlich vorgesehenen Hilfen.“ Die erwähnten „freien Flächen“ in Galiläa sind zum großen Teil Ländereien, deren ehemalige arabische Besitzer oder Pächter enteignet wurden. Deshalb war dieser Vorschlag für die Dorfbewohner inakzeptabel, und das wußte Begin.
Modell eines friedlichen Zusammenlebens
Seit 1979 leitet ein von der Vollversammlung gewähltes jüdisch-palästinensisches Sekretariat das Friedensdorf. Bei der Aufnahme von neuen Dorfbewohnern wird sorgfältig darauf geachtet, daß sich die Zahlen von Juden und Palästinensern im Gleichgewicht halten. Ein erster ernsthafter Konflikt zwischen Juden und Arabern droht auszubrechen, als die Juden im Dorf den Tag der israelischen Unabhängigkeit feiern wollen. Für die Araber ist jener Tag Jom al-Nakbah, der Tag der Katastrophe. An diesem Tag fing ihr Unglück an. Sie wurden beraubt, bestohlen, vertrieben. Die inzwischen dreiundzwanzig im Dorf ansässigen Familien, von denen neun arabisch sind, treffen sich deshalb zu einer außerordentlichen Vollversammlung, um den Konflikt zu lösen. Gemeinsam kommen sie überein, daß sie das Risiko der Uneinigkeit eingehen müssen, wenn sie in Frieden zusammenleben wollen. „Wenn ihr euer Unabhängigkeitsfest feiert, macht ruhig ein Freudenfeuer, aber ladet uns nicht dazu ein“, meint einer der Palästinenser an diesem Abend. Das offene Gespräch der Dorfbewohner in der Vollversammlung wird zum erfolgreichen Rezept, um Konflikte zwischen Arabern und Juden zu lösen.
Die Idee, Bildungseinrichtungen aufzubauen, welche die Grundsätze von NSH/WAS, friedliche Partnerschaft und Gleichberechtigung, realisieren, entstand mit der Geburt der ersten Kinder im Dorf. Eine binationale Kinderkrippe wurde eingerichtet und bald darauf ein Kindergarten und eine Grundschule, die einige Jahre später auch für Kinder von außerhalb des Dorfes geöffnet wurde. Die Schule dort ist die einzige vollständig zweisprachige Schule für jüdische und palästinensische Kinder in ganz Israel. Die pädagogische Arbeit beruht auf folgenden Grundsätzen:
- Gleich starke Beteiligung von Juden und Palästinensern an der Verwaltung und am Unterricht;
- langfristige Bereitstellung von Einrichtungen, die die natürliche Begegnung von Kindern beider Völker im Alltag ermöglichen;
- gleichberechtigter Gebrauch von Hebräisch und Arabisch als Unterrichtssprachen;
- Förderung der Identitätsbildung in den Kindern dadurch, daß man sie mit ihrer jeweiligen Kultur und Tradition vertraut macht und ihnen zugleich Achtung gegenüber der Tradition der jeweils anderen vermittelt.
Und so verwundert es nicht, wenn angesichts der täglichen Gewalttätigkeiten die Kinder des Friedensdorfes vor der laufenden Kamera eines Senders sagen: „Die sollten mal zu uns kommen. In Wahat al-Salam/Neve Shalom könnten sie viel lernen.“ Das Fernsehteam war ins Dorf gekommen, um zu sehen, wie sich die Situation hier in Zeiten der Intifada entwickelt.
Eine Schule, um Frieden zu lernen
Das eigentliche Herzstück der Arbeit des Dorfes ist die Friedensschule. Gegründet 1979 um die Ideen von NSH/WAS über die Dorfgrenzen hinaus nach außen zu tragen, arbeitet sie heute daran, bei Juden und Arabern ein größeres Bewußtsein für den Konflikt und ihre eigene Rolle darin zu entwickeln. Ursache der Feindseligkeiten zwischen Israel und den Palästinensern sei ein großes Mißverständnis, ist Eyas Shbeta, langjähriger Leiter der Friedensschule, überzeugt. Den Juden sei nicht klar, meint Shbeta, daß Israel eine Großmacht im Nahen Osten geworden ist, oder sie wollen es nicht zugeben. Sie fühlten sich noch immer bedroht und hätten Angst vor den Arabern, außer- und innerhalb ihrer Grenzen. Der Siedlungsbau, die Unterdrückung der Palästinenser, die Repressionen seien für sie eine legitime Verteidigung, für die Palästinenser hingegen eindeutige Aggressionen und Expansionsbestrebungen. Solange dieser Punkt nicht geklärt sei, erübrige sich jeder Versöhnungsversuch. Auch Evi Guggenheim Shbeta stellt fest, daß beide Seiten noch immer in einem Wettbewerb darüber festgefahren sind, wer das größte Opfer sei. Deshalb konnte laut Evi Guggenheim auch die ganze Versöhnungsarbeit noch nicht beginnen. „Ich glaube, es geht hier um die Anerkennung, daß den Palästinensern ein Unrecht angetan worden ist. Israel sollte in einem Versöhnungsprozeß für dieses Unrecht eine kollektive Verantwortung übernehmen“, ist Guggenheim überzeugt. „Psychologisch ist es sehr wichtig – genauso wie (Willy) Brandt um Verzeihung gebeten hat und auch der Papst um Verzeihung gebeten hat, muß ich als Jüdin und als Israelin um Verzeihung bitten.“ Um diesen Prozeß zu unterstützen wurde von einem Pädagogen der Friedensschule die jüdisch-palästinensische Organisation Sochrot („Erinnerungen“) ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, überall, wo palästinensische Dörfer waren, Gedenktafeln aufzustellen. Doch zur Zeit wird dieses Anerkennen des Unrechts von jüdischer Seite sehr angegriffen, ja sogar als Bedrohung empfunden. Die Ansicht, daß „die Araber so viele Länder hätten und die Juden nur eines“, sei gang und gäbe, betont Evi Guggenheim.
Recht auf eigene nationale Identität
In ihrer Arbeit in der Friedensschule stellen die Pädagogen immer wieder fest, daß sich die Beziehung zwischen den zwei Konfliktgruppen dann entspannt, wenn die Juden den Palästinensern das Recht auf ihre Identität zugestehen. Erst dann kann ein Dialog unter Gleichgestellten beginnen, und alle Probleme können besprochen werden. „Die Palästinenser verlangen weder Geld noch Komfort, sondern das Recht auf eine eigene nationale Identität, die Anerkennung ihrer Existenz“, meint Eyas Shbeta. Doch genau daran mangelt es im politischen Alltag Israels. Shbeta’s Frau erinnert sich zum Beispiel, daß man ihr bald nach ihrer Ankunft in Jerusalem einen israelischen Paß ausstellte, aufgrund des Gesetzes zur Rückkehr, weil ihre Vorfahren vor zweitausend Jahren in der Region gelebt hatten. Der Familie ihres Ehemannes hingegen verweigert man dieses Recht, obwohl sie bis vor wenigen Jahren hier lebte. „Natürlich kämpfe ich dafür, daß mein Volk ein sicheres Land mit unantastbaren und unangetasteten Grenzen hat, doch ich lehne es ab, daß es zum Nachteil der Palästinenser errichtet wird. Dieser Diebstahl erscheint mir ebenso niederträchtig wie der, den mein Großvater zu erleiden hatte, als man ihm in der Vorkriegszeit in Deutschland seine Praxis weggenommen hat.“
Immer wieder organisiert das Friedensdorf Initiativen, um den Not leidenden Palästinensern zu helfen. Einmal beteiligt es sich an einem internationalen Arbeitscamp, um die symbolträchtige Stadt Nazareth zu unterstützen. Diese besonders arme Stadt wird von der israelischen Verwaltung völlig vernachlässigt. Dabei handelt es sich um eine bewußte Entscheidung, denn eine benachbarte jüdische Stadt wird bestens unterstützt und unterhalten. Zwei große Aufgaben gilt es zu erledigen: Unterhalt und Reparatur der Straßen und Bürgersteige und die Renovierung der Schulen. Zusammen mit Einwohnern beteiligt sich Evi Guggenheim an der Ausbesserung der Straßen, welche in einem miserablen Zustand sind. Sie erinnert sich an eine Begegnung mit einem einheimischen Araber: „Als ich abends die letzten Schaufeln Erde in ein Loch werfe, spüre ich, daß ein alter Mann mich aufmerksam beobachtet. Hände und Kinn auf seinen Stock gestützt, sitzt er vor seiner Tür. Ohne sich von seinem Stuhl zu erheben, dankt er mir für meine Arbeit, dann fragt er: ‚Bist du Jüdin?‘ Ich lächle ihn an und bejahe. ‚Warum machst du dann vor meiner Tür sauber? Ich bin Araber.‘ – ‚Ich bin Sozialpädagogin, und ich gehe dahin, wo man mich braucht. Heute ist das hier dran.‘ Der Alte nickt: ‚Gut, sehr gut sogar, danke. Möge Allah dich schützen!‘“
Aufschwung dank Oslo
Den größten Aufschwung erlebt das kleine Dorf während der Zeit der Osloer Friedensverträge und der Präsidentschaft Yitzhak Rabins in den Jahren 1993 bis 1995. Die Verträge sind ein Beweis dafür, daß das Dorf seiner Zeit voraus ist. Neve Shalom/Wahat al-Salam wird im ganzen Land bekannt, wird zum Vorbild, zum Hoffnungsträger. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Studenten der Friedensschule verdoppelt. Immer mehr Familien möchten sich hier niederlassen. Es sind so viele, daß mehrere Kandidaten abgelehnt werden müssen, damit das Dorf nicht an einer Expansion, die es nicht mehr im Griff hat, scheitert. Auch die Beziehungen zur israelischen Regierung entwickeln sich positiv. Die Grundschule von NSH/WAS wird staatlich anerkannt, was natürlich auch finanziell eine Erleichterung bedeutet. Neben der materiellen Hilfe erklärt das Erziehungsministerium die jüdisch/palästinensische Schule zur Modellschule und ermuntert alle pädagogischen Einrichtungen des Landes, sich von dem Beispiel inspirieren zu lassen.
Ein großer Schock ist daher die Ermordung Rabins im November 1995. Mit seinem Tod droht die in Oslo geborene Hoffnung zu zersplittern. Ein politischer Umschwung erfolgt, die Auswirkungen der veränderten Mehrheitsverhältnisse bekommt die Friedensoase bald zu spüren: Der Status der Grundschule wird geändert und in ein System gezwängt, das noch ungünstiger ist als dasjenige bei Gründung der Schule. Auch der Schulbus wird gestrichen. Doch zum Glück profitiert das Dorf davon, daß es inzwischen international bekannt geworden ist und viele Gönner und Spender im Ausland gefunden hat. Seine Bekanntheit über die Landesgrenzen hinaus schützt es auch vor der heutigen Regierung, der es ein Dorn im Auge ist. Trotz dem Beginn der zweiten Intifada sind die Schülerzahlen erfreulicherweise nicht zurückgegangen, sondern nehmen weiterhin Jahr für Jahr zu und auch die Seminare an der Friedensschule ziehen immer mehr Studenten an – etwa gleich viele Juden und Araber. Viele von ihnen erzählen, daß sie gerne und ohne Vorbehalte hierher kommen, weil sie nicht den Eindruck haben, „zum anderen zu gehen“. Es ist also gelungen, Wahat al-Salam/Neve Shalom zur Heimat beider Völker zu machen. Dieser Ort gehört allen. Er ist weder jüdisch noch palästinensisch, sondern palästinensisch und jüdisch, das heißt völlig neutral. Jeder kann sich hier zu seiner Nationalität bekennen und sie ausleben, ohne emotionale Reaktionen oder Provokationen befürchten zu müssen. „Wir streben keine gemeinsame Identität an, im Gegenteil, wir ermuntern diejenigen, die unserem Unterricht folgen, über ihre eigene Identität nachzudenken, die tief in ihrem Inneren verborgenen Wurzeln aufzuspüren, um zu sagen, wer sie sind, woher sie kommen, was ihnen lieb und teuer ist und warum. Unser Ziel ist es nicht, daß ein Araber nach unseren Zusammenkünften sagt: ‚Ich bin Jude geworden‘, sondern daß er erklärt: ‚Ich weiß, warum ich Palästinenser bin; ich bin stolz darauf. Ich weiß auch, warum mein Freund Jude ist, und ich weiß, warum er es sein will.‘ Das gilt natürlich für beide Seiten gleichermaßen.“
„Ich bin überzeugt, daß dies der einzige Weg ist, der zum Frieden führt, und daß wir unserer Zeit voraus sind, denn er zeugt von einer Geisteshaltung, die irgendwann dem ganzen Land bewußt werden wird“, schreibt Eyas Shbeta.
Heute (2005) leben fünfzig Familien im Dorf, bis im Jahr 2013 werden es nach Hochrechnungen zweihundert Familien sein. Dann wird sich das Dorf etwas anderes einfallen lassen müssen, denn aus Platzgründen kann es nicht mehr Menschen aufnehmen. Heute sind die Straßen geteert, es gibt ein hübsches, wunderbar gelegenes Hotel, das einen traumhaften Blick über das Ayalon-Tal bietet. Es gibt neue Häuser, einen Kindergarten, zwei Grundschulen, die von dreihundert Kindern aus den umliegenden achtundzwanzig Gemeinden besucht werden, und neu auch ein Gymnasium. Nächster Plan ist die Eröffnung einer Friedensakademie. Zudem wurde ein überkonfessionelles, spirituelles Zentrum geschaffen, die Doumia (Stille), ein Gebäude mit einer schlichten Kuppel in schöner Lage. Inspiriert von Bruno Hussar, welcher in der Bibel fand, daß Gott dem Menschen im Schweigen nahekommt, soll dieses Zentrum ein Ort der Stille sein, wo jeder still beten oder meditieren kann, ohne andere zu stören.
Der Traum von Bruno Hussar ist also Wirklichkeit geworden. In seinem Dorf leben heute Juden, christliche und muslimische Araber friedlich, gleichberechtigt und mit Respekt vor den Traditionen eines jeden zusammen. Der Priester wurde für seine Arbeit dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert. Er starb am 8. Februar 1996. Am Vortag seiner Beerdigung liest Evi Guggenheim Shbeta noch einmal die Zeilen, die er ihr ganz am Anfang des Abenteuers geschrieben hat: „Dort, wo keine Liebe ist, sollt ihr Liebe säen. Jede Saat trägt eines Tages Früchte. Ihr werdet sie vielleicht nicht selbst ernten, aber andere werden kommen, um sie zu pflücken. Das ist das wahre Ziel von Neve Shalom/Wahat al-Salam: Bewahrt euch die Hoffnung und sät viel Liebe. Der Tag der Ernte kommt zu seiner Zeit.“