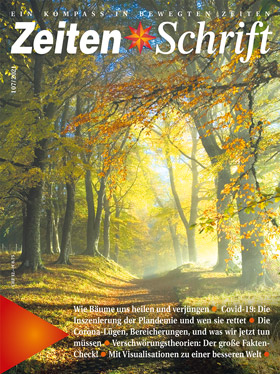Hoch lebe die Liebe
Ein liebevolles Miteinander scheint gerade in der ganzen Gesellschaft zur Mangelware zu werden. Doch Lieblosigkeit entspricht nicht unserer Natur. Deshalb macht sie uns krank, sagt die Wissenschaft. Und: Ohne unsere Mitmenschen kommen wir nicht weit!

Einsamkeit ist der größte Krankmacher, hat der oberste Arzt der USA unlängst erkannt. Doch tätige Nächstenliebe hebt uns darüber hinaus.
Lieben Sie sich? Mit Haut und Haar, bedingungslos, auch wenn die Frisur nicht sitzt und selbst wenn Sie sich beim letzten Date wie ein Esel aufgeführt haben? Ich wage zu behaupten, längst nicht alle werden an dieser Stelle sogleich mit einem lauten und enthusiastischen „Ja, sicher!“ antworten. Zumindest ein leises Zögern könnte da schon sein … Tatsächlich gehen Menschen mit sich selbst oft sehr viel härter ins Gericht als mit ihrem Gegenüber. Die Lieblosigkeit aber – sei es zu sich selbst oder zu anderen – kommt mit einem hohen Preis, sie macht uns auf Dauer nämlich krank.
Krankheit ist nichts, was uns aus heiter hellem Himmel von außen überfällt, sondern Krankheit hat in der Regel auch mit uns selbst zu tun. (Natürlich gibt es auch krank machende Substanzen und Einflüsse, Gifte oder Mikrowellenstrahlung zum Beispiel. Doch auch hier haben wir es bis zu einem gewissen Grad in der Hand, wie stark wir darauf reagieren.) Umgekehrt könnte man sagen, Gesundheit ist unser natürlicher Zustand. Jeder lebende Organismus strebt ständig von sich aus nach Gesundheit. Der menschliche Körper verfügt zu diesem Zweck über verschiedene integrative Regelsysteme, die jederzeit bemüht sind, im Körper eine Balance oder Kohärenz1 herzustellen. Zu diesen Regelsystemen gehören das Nerven-, das Hormon- und das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System und wahrscheinlich auch ein weitverzweigtes Kommunikationssystem, das wir bislang als Bindegewebe bezeichnen. Gesteuert werden diese Regelsysteme, welche die Funktion unserer Zellen und Organe koordinieren, von unserem Gehirn (dem Gehirnstamm, wenn man es genau nimmt). Auch wenn unser Gehirn „nur“ das Klavier ist, auf dem unser geistiges Bewusstsein – unser eigentliches Wesen – gleichsam spielt, so ist es trotzdem die wichtigste Schaltzentrale für die Vorgänge in unserem Körper.2 Und deswegen ist an dieser Stelle häufiger als nicht auch der Hund begraben.
Unser Gehirn mag es nämlich gemütlich. Wenn alles im Gleichgewicht ist, wenn die älteren und jüngeren Gehirnbereiche reibungslos zusammenarbeiten, ebenso die rechte und die linke Gehirnhälfte, wenn Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bilden, dann ist es unserem Gehirn richtig wohl, es verbraucht nur wenig Energie. Ganz anders, wenn unsere Schaltzentrale mit einem Problem oder Konflikt konfrontiert wird, wenn sie neue, unbekannte Dinge wahrnimmt, wenn sie zum Denken oder gar zu Veränderungen gezwungen ist: Dann steigt der Energieverbrauch im Gehirn drastisch an. Das ist übrigens mit ein Grund, warum der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Gewohnheiten bieten einen gewissen stabilen Zustand, wir machen Dinge automatisch, das Hirn muss nicht viel arbeiten. Veränderungen hingegen brechen alte Muster auf, sie destabilisieren und schaffen Inkohärenz. Wir werden ein wenig durchgeschüttelt, damit hernach im Oberstübchen die Dinge neu geordnet werden können. Insofern sind (krisenhafte) Veränderungen auch eine Chance zur Umwandlung – sofern wir irgendwann eine Lösung finden.
Doch dies alles erfordert Anstrengung, deshalb belassen wir die Dinge häufig lieber beim Alten. Allerdings ist es eine Illusion zu glauben, die Dinge blieben stets so, wie sie sind. Allein schon durch die Tatsache unseres Daseins – und würde dieses nur darin bestehen, dass wir essen, schlafen und atmen – verändern wir ständig unsere Umwelt. Dies regt uns an, nach Lösungen zu suchen, um wieder Ordnung herzustellen.
Autonom und doch gemeinsam

Bereits kleine Gesten der Freundlichkeit trainieren unser Gehirn zu liebevollem Umgang mit anderen.
So weit, so gut, es ist ja nichts falsch daran, nach dem zu suchen, was uns gesund und glücklich macht. Das Problem besteht vielmehr darin, dass wir das, wovon wir denken, dass wir es brauchen, um glücklich zu sein, mit dem verwechseln, was wir wirklich brauchen. Unser Verstand ist ja eine feine Sache. Er ermöglicht es uns, Vorstellungen davon zu entwickeln, wie etwas gemacht werden muss. Er hilft uns, Lösungen zu finden. Allerdings weiß er herzlich wenig davon, was im Leben wirklich zählt und was wir benötigen, um unsere Bedürfnisse zu stillen.
Zu den tiefsten menschlichen Bedürfnissen gehört unser Streben nach Autonomie und Freiheit. Wir wollen wachsen und uns entwickeln können, wir wollen unser Leben und die Welt um uns herum gestalten können. Wir können gar nicht anders, denn diese Freiheit zu erschaffen ist unser Geburtsrecht und unsere Bestimmung.
Andererseits sind wir zutiefst soziale Wesen. Als Einzelwesen sind wir nicht überlebensfähig. Selbst der Einsiedler hat Familie, auch wenn er diese vielleicht nicht mehr sieht, auch er wuchs an der Brust seiner Mutter auf. Unser Freiheitsdrang und unser inniges Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit und Gemeinschaft sind so stark wie Hunger und Durst. Und ebenso, wie wenn uns Essen und Trinken vorenthalten werden, leidet unsere Gesundheit, wenn diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden.
Tatsächlich finden in unserem Gehirn physische Veränderungen statt, wenn wir unsere grundlegendsten Bedürfnisse unterdrücken müssen. Glauben wir beispielsweise an Darwins Prämisse des „Survival of the fittest“, also das Überleben des Stärkeren, und sehen wir daher unseren Mitmenschen als Konkurrenten im Rennen nach Anerkennung, Besitz, Reichtum, Macht oder Erfolg, dann ist das nur möglich, indem wir gleichzeitig unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit zum Schweigen bringen. Erfahren wir aber von anderen Menschen Lieblosigkeit, Ausgrenzung oder Ablehnung, dann ist dieser „soziale“ Schmerz ebenso stark, wie wenn uns der andere physischen Schmerz zufügen würde. Das ist wörtlich zu nehmen. Bei sozialem Schmerz werden im Gehirn dieselben Netzwerke aktiviert wie bei körperlichem Schmerz!