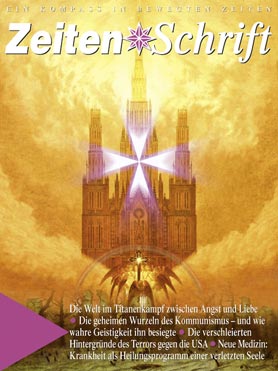Sag mir, wo die Führer sind...
Charisma: Von jener Ausstrahlung, die manche haben und viele nicht. Wir gegen der Frage nach, weshalb es unserer Welt an charismatischen Politikern mangelt. Und sagen, weshalb die Welt nicht verloren ist, solange es noch Gänseblümchen gibt.

Menschen wie Jeanne d’Arc, welche ganze Völker zu inspirieren und beflügeln vermögen, sind selten geworden in unserer Zeit.
Für mich", sagte Daisy, eine Freundin, kürzlich zu mir, "hat Jacques Chirac das Charisma eines Glacéhandschuhs: nobel, elegant, aber nur Oberfläche. Joschka Fischer erinnert mich an das Kasperle, das an ein Kostümfest geht und sich deshalb in ganz feines Tuch gestürzt hat, aber jeder merkt gleich, daß es nur das verkleidete Kasperle ist. Und George Bush", seufzte Daisy, und ihr Gesichtsausdruck bekam etwas zutiefst hoffnungsloses - "George Bush wirkt wie ein windiger TV-Prediger, der einst von Haus zu Haus Bürsten verkauft hat, sich immer das Elend frustrierter Hausfrauen anhören mußte und dann beschloß, mit Heilsverkündigungen am Fernsehen eine Menge Kohle zu machen."
"Du bist grausam", sagte ich, doch Daisy ließ sich nicht von ihrer Meinung abbringen. "Ich bin nur ehrlich. Nenn' mir mal einen Staatsmann von heute, der wirklich noch Format hat. Oder sogar sowas wie Charisma."
Ich dachte angestrengt nach. "Nelson Mandela." - "Hm, okay", lenkte Daisy ein. "Das ist aber auch der einzige. Und er ist seit einigen Jahren nicht mehr im politischen Geschäft." "Tony Blair". "Nicht wirklich. Nur weil einer das Hemd über die Hose hängen läßt und einen frischen Lausbubenblick spazieren führt, ist er noch kein großer Staatsmann", urteilte Daisy gnadenlos. "Woran liegt das? Wieso werden wir heutzutage von Politikern regiert, die die Ausstrahlung von Papierservietten haben und das Sendungsbewußtsein eines Schirmständers?"
"Jedes Volk hat die Politiker, die es verdient", sagte ich, und versuchte abgeklärt-weise zu wirken. "Eben!", rief Daisy. "Das ist es ja! Wo sind wir angelangt, wenn wir freiwillig solche Politiker wählen?"
"Hm, gute Frage", sagte ich und war mit meiner abgeklärten Weisheit am Ende. Doch zum Glück habe ich eine gut bestückte Bibliothek, und so hielt ich Daisy zwei Tage später das Buch Zivilcourage von John F. Kennedy unter die Nase.
Der schrieb nämlich Mitte der Fünfziger Jahre: "Walter Lippmann ist nach fast einem halben Jahrhundert sorgfältiger Beobachtung in seinem jüngsten Buch zu einem harten Urteil sowohl über Politiker als auch über Wähler gelangt. 'Abgesehen von Ausnahmen, die ebenso selten wie Naturwunder vorkommen, sind erfolgreiche Politiker in einer Demokratie unsichere und eingeschüchterte Geschöpfe. Ihr politischer Fortschrittwird nur dadurch ermöglicht, daß sie faule Zugeständnisse machen, bestechen, verführen, schwindeln oder sonst irgendwie die fordernden und bedrohenden Elemente unter ihren Wählern zu manipulieren versuchen. Entscheidend ist gar nicht mehr, ob ein Vorschlag gut ist, also nicht, ob er sich bewähren, sondern vielmehr, ob die aktive und beredte Wählerschaft ihn sofort gutheißen wird.'"
"Zappenduster", sagte Daisy in ihrer gewohnt flapsigen Art. "Da können wir uns ja gleich auf den Scheiterhaufen der Geschichte legen."
"Übertreib doch nicht ständig", antwortete ich. Daisy konnte einem schon auf die Nerven gehen. "Es ist ja gar noch nicht fertig. Präsident Kennedy – damals war er noch Senator – ist mit Lippmann nämlich nicht unbedingt einverstanden." Ich las weitervor:
"Nach dem ich fast zehn Jahre inmitten der 'erfolgreichen Politiker einer Demokratie' gelebt und gearbeitet habe, bin ich gar nicht mehr so sehr davon überzeugt, daß sie alle 'unsichere und eingeschüchterte Männer' sind. Vielmehr bin ich sicher, daß die komplexe Natur der öffentlichen Geschäfte und der Wettbewerb um die Gunst des Publikums dazu beigetragen haben, daß eine unerhört große Anzahl von Bewährungsproben der Zivilcourage, sowohl große als auch kleine Fälle, täglich in den Räumen des Senats geliefert werden. Ich bin weiter hin davon überzeugt, daß der behauptete Niedergang - wenn überhaupt - weit weniger im Senat als bei seinen Kritikern in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, was das Verständnis und die Aufgeschlossenheit für die Natur und die Notwendigkeit des Eingehens von Kompromissen und des Ausgleichs sowie all das, was wesensmäßig im Senat als einer gesetzgebenden Körperschaft vor sich geht, betrifft. Letztlich bin ich davon überzeugt, daß wir uns nicht völlig der Verantwortung eines Senators seinen Wählern gegenüber bewußt geworden sind oder nicht berücksichtigt haben, welchen Schwierigkeiten ein Politiker sich unausgesetzt gegenübersieht, der gewissenhaft bemüht ist – um Worte von Webster zu zitieren - 'seinen einsamen Nachen in einer feindlichen, stürmischen See manövrierfähig' zu erhalten. Wenn das amerikanische Volk in der Lage wäre, sich jenes ungeheuren Drucks bewußt zu werden, welcher eine Offenbarung politischen Muts belastet, eines Drucks, der manchen Senator dazu zwingt, sein Gewissen außer Acht zu lassen oder zumindest zu unterdrücken, dann wäre es vielleicht weniger kritisch gegenüber denjenigen, welche die breite, widerstandslose Bahn eingeschlagen haben, und andererseits wüßte es umso höher diejenigen zu schätzen, welche trotz aller Fährnisse dem schmalen Pfad der Tugend des Mutes folgen."
Triumphierend blickte ich Daisy an. "Ist das keine Antwort?" Daisy hatte ihre Unergründlichkeitsmiene aufgesetzt, wie sie es immer tut, wenn eine Message als diffuser Nebel in ihr Gehirn wabert. "Verstehst du denn nicht?", fragte ich, bemüht, in keinen allzu rechthaberischen Ton zu fallen."Kennedy sagt im Grunde, daß die Medien in ihrer Beurteilung der Politiker immer härter und gnadenloser geworden sind; daß sie dadurch den Druck auf sie immer mehr verstärkt haben und es deshalb für die Politiker immer schwieriger geworden ist, ihrem Gewissen zu folgen."
Ich war in Fahrt. "Überleg' doch mal, welche Politiker wirklich noch staatsmännisches Format hatten. Churchill zum Beispiel. Konnte seinem Volk nichts weiter als 'Blut, Schweiß und Tränen' verheißen und hatte doch ganz England hinter sich. Und warum? Weil in den Zeiten des Krieges die Presse es sich nicht erlauben durfte, am ersten Mann im Staat Kritik zu üben. Das hätte die nationale Wehrfähigkeit beeinträchtigt. Wäre vielleicht sogar fast Landesverrat gewesen.
Oder Mandela: Erster schwarzer Präsident eines Landes, das zuvor schlimmste Rassendiskriminierung praktiziert hatte. Da war es politisch unmöglich, ihn medial anzugreifen. Sogar Präsident Roosevelt war ziemlich sakrosankt - zuerst, weil Amerika in der tiefsten wirtschaftlichen Krise seiner Geschichte steckte, und dann, weil es sich im Krieg befand. Genau dasselbe geschieht doch heute mit Bush: Infolge der Terror-Tragödie können es sich die Medien gegenwärtig nicht leisten, ihn zu kritisieren oder gar fertigzumachen. Nicht daß du jetzt meinst, ich wolle mittelmäßige und charakterschwache Politiker einfach in Schutznehmen", sagte ich," doch denke ich, daß wir als Öffentlichkeit auch mit schuld sind, wenn es für sie immer schwieriger wird, eine aufrichtige Politik zu betreiben - weil wir sie, sobald sie einen unpopulären Entscheid treffen, sofort in Stücke reißen."