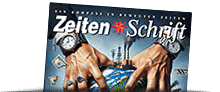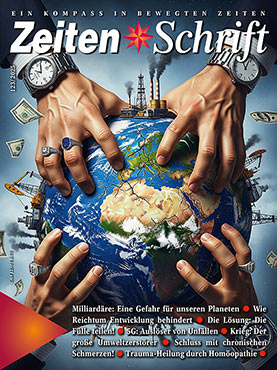Von Ellen Diederich

Mehrere Maschinen landen nachts um drei gleichzeitig in Tel Aviv. Vergleichbare Prozeduren wie in den USA, Einreisekarten mit allen möglichen Fragen, endlose Schlangen vor den Schaltern, unfreundliche Beamte. Wohin, mit wem, warum alleine, usw. Israel hat 6,5 Millionen Einwohner, ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Das Pro-Kopf-Einkommen rangiert an 16. Stelle der Weltrangliste. Israel erhält 40 Prozent aller US-amerikanischen Auslandshilfe. Das waren in den letzten Jahren im Durchschnitt 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Zwei Lobbygruppen in den USA sorgen darüber hinaus für weitere Finanzhilfen: die zionistischen Organisationen und die christlichen Fundamentalisten, zu denen auch George W. Bush gehört. Nach ihren Vorstellungen wird der Messias wieder erscheinen, wenn alle Juden der Welt auf dem Gebiet des alten Palästina vereint sind. Von daher unterstützen sie die Siedlungspolitik.
Die USA haben an der Region großes strategisches Interesse, ihr engster Verbündeter ist Israel. Sie bestimmen die Politik. Israels Militär ist bestens trainiert und verfügt über modernste Waffentechnik. Die Kriege, die Israel geführt hat, waren immer auch ein Test für neues US-amerikanisches Militärgerät. Darüber hinaus diente Israel als Transferort für US-amerikanische Waffen in solche Regionen, in denen direkte Lieferungen aus den USA Protest hervorgerufen hätten, nach Südafrika während der Apartheid oder nach Mittelamerika. Israel ist das einzige Land der Welt, das Kernwaffen besitzt und offiziell nicht in den Kreis der Atomwaffenmächte eingebunden ist, somit auch nicht an den Verhandlungen über strategische Nuklearabrüstung teilnimmt.
Alltag unter der Besatzung
Von Jerusalem aus geht es zu Fuß über den Bethlehem-Checkpoint. Hinter dem Kontrollpunkt wird eine riesige Anlage gebaut. Dort sollen von der allernächsten Zeit an alle israelischen LKW, die Waren für Palästina haben, stoppen. Sie werden dort ausgeladen. Palästinensische LKW übernehmen die Ladung und transportieren sie weiter. Es wird die Frachtkosten erhöhen, die Transferzeit verlängern. In Palästina selbst werden wenige Dinge produziert, nahezu alle Waren kommen aus oder über Israel. Vor allem aber kommt das Wasser aus den Palästinensergebieten. Es wird von Israel abgepumpt, die Palästinenser zahlen dann für ihr eigenes Wasser den zigfachen Preis dessen, was Israelis bezahlen.
Diese dürfen nur noch unter großen Schwierigkeiten nach Palästina reisen. "Sie könnten gekidnappt, ermordet werden, die IDF (Israelischen Defence Forces) können für ihre Sicherheit nicht garantieren", heißt die offizielle Erklärung. Somit gibt es auch für diejenigen, die gutwillig sind, immer weniger Möglichkeiten, sich wirklich über das zu informieren, was hier geschieht.
Ende Dezember beteilige ich mich an einer Aktion der "Frauen in Schwarz" in Tel Aviv gegen die Besatzung und für die Auflösung der illegalen Siedlungen. Die Frauen in Schwarz sind eine von Israelinnen gegründete Friedensgruppe. Sie organisieren permanente Beobachtungen der Checkpoints und Informationsfahrten zu verschiedenen Abschnitten der Mauer, machen regelmäßig Mahnwachen in Jerusalem.
Die erste Station meiner Reise ist Beit Jala bei Bethlehem. Dort treffe ich Faten und Nicola Mukarker. Faten ist Schriftstellerin, die Vorträge in Deutschland hält. Hier bekomme ich eine Ahnung davon, was eine palästinensische Großfamilie ausmacht.
Zwanzig- bis dreißigmal am Tag geht die Türglocke, mindestens ebenso häufig das Telefon, Tanten, Schwäger, Schwestern, Neffen und Nichten, Cousinen und Cousins kommen vorbei. Alles wird besprochen. Nahezu die ganze Straße wird von Familienangehörigen bewohnt. Durch die Aprikosengärten der Familie soll jetzt die Mauer gebaut werden. 2004 konnten so gut wie keine Aprikosen verkauft werden. Als die Erntezeit kam, hatte Israel den palästinensischen Markt mit billigen Aprikosen überschwemmt.
In den palästinensischen Dörfern werde ich das Gefühl von "halbfertig" nicht los. Die Häuser sind halbfertig. Die Menschen hatten angefangen zu bauen, dann die Arbeit verloren. Etwa 1,5 Millionen Olivenbäume, die Grundlage der palästinensischen Landwirtschaft, eine Million Zitrus- und andere Obstbäume haben Israelis in den Palästinensergebieten abgeschlagen, 1,5 Millionen Hühner getötet. Die Gärten können oft nicht richtig bestellt werden. Unterhalb der Siedlungen lassen die Siedler oft ihre Abwässer in die palästinensischen Gärten laufen, so daß diese nicht bebaut werden können. Kann ein Stück Land ein Jahr nicht bebaut werden, fällt es an den Staat. Jede Form der Subsistenzproduktion der Palästinenser wird behindert oder zunichte gemacht. Die Menschen werden abhängig von Spenden und internationalen Gebern.
Die Familie von Faten und Nicola lebt im ersten Stock des Elternhauses von Nicola. Ich gehe die Eingangstreppe hoch. Sie ist durch Fatens Schilderungen bekannt geworden. Es war in der Zeit vor zwei Jahren nach Beginn der zweiten Intifada. Die palästinensischen Häuser haben keine Keller. Als die Bombardierungen und Schüsse Beit Jala im Herbst und Winter 2002 trafen, saß die Familie unter der Treppe als einzigem, unsicheren Schutzraum. In den Zimmern konnte sie sich nicht bewegen, da auf alle, die durch die Fenster von draußen zu sehen waren, geschossen wurde. Beit Jala stand, wie viele andere Dörfer und Städte, wochenlang unter Ausgangssperre. Ausgangssperre bedeutete, nicht hinausgehen zu dürfen, nicht einkaufen zu können, man erstickte im Müll, konnte ihn nicht loswerden. Die Angst der Kinder mußte aufgefangen werden. Diese konnten nahezu ein halbes Jahr nicht zur Schule gehen.
Aus den Straßen Palästinas sind die Kinder nicht, wie weitgehend in Deutschland, verschwunden. Kinder sind überall gegenwärtig. Die Straße ist ihr Ort. Wochenlanges Eingesperrtsein, unterhalb der Fenster kriechen, mit den durch die Bombardierungen hervorgerufenen Ängsten umgehen lernen, sich im Haus möglichst ruhig verhalten, sind unmenschliche Lebensbedingungen, die so schnell nicht vergessen werden können.
Terror und Staat
Der Konflikt zwischen Israel und Palästina ist ein Modellfall für den Umgang ökonomisch starker Länder mit schwachen. Israel nimmt sich jedes Recht auf Gewaltanwendung, sei es die Tötung von Menschen, Annexion und Zerstörung von Land, Gebäuden, Infrastruktur. Folter ist zwar nicht legalisiert, wird aber angewandt, Gefängnishaft findet unter unwürdigsten Bedingungen statt, oft monate- bis jahrelang, ohne daß ein Urteil gesprochen wird. Israel kontrolliert die Zugänge zur Arbeit, zur Religionsausübung, zur Wasserversorgung und zur Landnutzung. Es entscheidet darüber, ob Schulen, Universitäten und Krankenhäuser geöffnet sein können oder nicht. Alle internationalen Resolutionen der UNO oder die Verurteilungen dieser Zustände durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag haben nicht zu Veränderungen geführt.
Palästina, der ökonomisch schwachen Seite, wird jedes Recht auf Widerstand gegen die Zerstörung seiner Lebensgrundlage abgesprochen. Jede Protestaktion wird als terroristisch definiert, ist also illegitim und militärisch legal zu bekämpfen. Über die Menschen, ihre Kultur, wird international so gut wie nichts berichtet, sie werden als Terroristen und gewalttätig diskreditiert. Hier wächst die Zahl derjenigen, die sich als Schahids (Selbstmordattentäter) ausbilden lassen. Die Selbstmordattentate sind unmenschliche Aktionen der Verzweiflung, sie kosten das Leben vieler unschuldiger Opfer und der Attentäter.
An zentralen Plätzen habe ich beklemmende Gefühle. Beim Warten am Taxistand oder dem Busbahnhof in Tel Aviv, an großen Kreuzungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Israel gibt als Begründung für seine ungeheure Aufrüstung und den Mauerbau die Bedrohung durch Selbstmordattentate an. Das Alltagsbild in seinen Straßen prägen zigtausend junge Soldatinnen und Soldaten, ausgerüstet mit Maschinengewehren. Überall sind sie zu sehen, schlendern durch Einkaufszentren, über Bahnhöfe, Busbahnhöfe, häufig die Freundin oder den Freund am Arm. Meine Frage, ob sich die Menschen in Israel durch so viele Soldaten beschützt fühlen, wird von kaum jemandem bejaht.
Auf einer Zugfahrt vom Norden Israels in den Süden machen Armeeangehörige nahezu die Hälfte der Fahrgäste aus. Kommen mir die Gesichter so jung vor, weil ich inzwischen alt bin, oder sind es wirklich fast Kinder? Welche Lebenserfahrung können sie mit 18, 19 Jahren gesammelt haben? Die israelische Zeitung Haaretz veröffentlichte im Dezember 2004 die Ergebnisse einer Umfrage: Über 20 Prozent der israelischen Soldaten gaben an, daß sie das Leben eines arabischen Menschen geringer achten als das Leben eines jüdischen Menschen. Da man so etwas nicht gerne zugibt, ist die Dunkelziffer vermutlich hoch. Anstatt die Ursachen der Gewalt anzugehen, werden immer mehr Formen von Gewalt entwickelt.
Die zweite Intifada
Seit Beginn der zweiten Intifada im September 2001 eskalierte die Gewalt. "Das Wort Intifada bedeutet: Etwas von sich abschütteln, was man loswerden möchte, es meint auch Beben des Körpers, der vor Wut und Aufregung von Krämpfen geschüttelt wird. Intifada wurde zur Bezeichnung für die palästinensische Volkserhebung gegen die israelische Besatzung." (Sumaya Farhet-Naser, "Thymian und Steine", Basel 2000, S. 121)
Damals provozierte Ariel Scharon die PLO mit einem demonstrativen Besuch des Tempelberges. Und Mordachai erschoß die Betenden in der Moschee. Der Provokation folgten Selbstmordattentate von Palästinensern, massive Raketenangriffe und Militäraktionen Israels gegen Palästina. Bis heute sind an die 5000 Menschen dabei ums Leben gekommen, etwa 3700 auf palästinensischer, 1300 auf israelischer Seite. Unzählige Häuser wurden zerstört, aber auch die Infrastruktur Palästinas wie der Flughafen in Gaza und die Selbstverwaltungseinrichtungen der Palästinensischen Autonomiebehörde, bis hin zum zentralen Katasteramt, so daß es heute sehr schwierig ist, Landbesitz nachzuweisen. Die Wirtschaft Palästinas liegt am Boden, aber auch in Israel haben sich die Lebensverhältnisse eines großen Teils der Bevölkerung rapide verschlechtert. 25 Prozent der israelischen Kinder leben heute unterhalb der Armutsgrenze. Die meisten von ihnen sind moslemische Kinder arabischer Herkunft.
Die Globalisierungsprozesse gehen nicht spurlos an Israel und Palästina vorbei. Auch hier werden, wie überall, Betriebe geschlossen, weil anderswo billiger produziert werden kann. Ein Teil der Familie Mukarker z. B. lebte von einem kleinen Betrieb mit 14 Arbeitern, in dem Gummi produziert wurde. Heute arbeitet nur noch der eine Bruder im Betrieb. Der Gummirohstoff kam aus Malaysia, mußte, wie alles, über Israel importiert werden. Palästina hat keinen eigenen Hafen und keinen Flughafen, so kann nichts direkt eingeführt werden. China ist wesentlich billiger in der Produktion von Gummi, Palästina konnte nicht konkurrieren. Zudem werden viele Dinge, die früher aus Gummi hergestellt wurden, heute auf der Grundlage von Erdöl produziert.
Globalisierungskritiker
In beiden Ländern gibt es Gruppen, die sich mit der weltweiten Bewegung gegen die konzerngesteuerte Globalisierung verbunden fühlen. Es existiert aber eine Asymmetrie hinsichtlich der Arbeitsmöglichkeiten der NGOs. Die israelischen Aktivisten sind Bürger eines etablierten Staates. Sie können die Politik dieses Staates mit einem relativ geringen Risiko kritisieren. Sie können sich innerhalb ihres Landes frei bewegen, haben kein Problem, sich mit internationalen Bewegungen zu vernetzen und an Treffen globalisierungskritischer Bewegungen teilzunehmen.
Die Palästinenser hingegen arbeiten unter den Bedingungen einer illegalen Besatzung. Die palästinensischen Organisationen leiden an der Bewegungsunfreiheit im eigenen Land. Israelische Sicherheitskräfte verwehrten mehrfach Mitgliedern des globalisierungskritischen Alternativen Informationszentrums Visa zur Teilnahme an Foren und Aktionen.
Verschiedene nationale palästinensische Organisationen gründeten 2001 die AGM, die Alternative Globalization Movement. Eine der Organisationen ist das Zentrum für Arbeiter- und Demokratierechte, das vor allem zu ATTAC enge Verbindungen aufgebaut hat. Das Koordinationsnetzwerk der palästinensischen NGOs und das Bissau-Zentrum vertreten die palästinensischen Organisationen im Weltsozialforum. Israelische und palästinensische Organisationen arbeiten im Alternativen Informationszentrum AIC zusammen. Ende Dezember 2002, kurz vor dem zweiten Weltsozialforum in Porto Alegre, fand das erste palästinensische Sozialforum in Ramallah statt, an dem sich Hunderte Aktivisten beteiligten. Im späten August 2003 gab es ein internationales Treffen in Bethlehem unter dem Slogan: Ein Naher und Mittlerer Osten ohne Krieg und Unterdrückung ist möglich! Es war das erste Treffen mit internationaler, palästinensischer, aber auch israelischer Beteiligung in einer palästinensischen Stadt. (Infos aus "Globalization and the Palestinian Struggle", in: News from within, Oct./Nov. 2004, Jerusalem, Übersetzung: E. D.)
Die Rolle der Weltbank
Die Weltbank hat sich eingeschaltet, verhandelt mit beiden Ländern. Sie will eine Geberkonferenz organisieren. Als Voraussetzung fordert sie von Palästina, ausreichende Schritte in Richtung Wirtschaftswachstum zu unternehmen und die Korruption zu beseitigen. Von der palästinensischen Verwaltung fordert sie, weitreichende Reformen im Bereich von Sicherheit, Justiz und Ökonomie in Gang zu setzen. Wie soll das geschehen, wenn die Infrastruktur permanent zerschlagen wird?
Von Israel fordert die Weltbank, Sperren und Restriktionen zu lockern, die die Mobilität auf dem Territorium der Palästinenser einschränken. Israel hat angeboten, die Abriegelung etwas zu lockern. Das Angebot geht der Weltbank nicht weit genug. Die Abriegelungen durch unzählige Checkpoints im Lande behindern ihrer Meinung nach den palästinensischen Handel und Export und verteuern die Transporte erheblich. Die Weltbank will, daß die Übergänge auf der Grünen Linie, wie in den Osloer Verträgen und im Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag festgelegt, gebaut werden. Weiter schlägt sie den Bau eines Seehafens in Gaza und die Wiederherstellung des Flughafens vor.
Die Mauer
Der Bericht der Weltbank kritisiert auf der einen Seite Israels Politik der permanenten Abriegelung, stellt aber auf der anderen Seite den Bau der Mauer nicht grundsätzlich in Frage.
Wir fahren in Bethlehem zu dem Ort, an dem jetzt ein Teil der Mauer gebaut wird. Über 700 Kilometer sind rings um Palästina geplant. Israel baut die Mauer auf palästinensischem Gebiet, nimmt den Palästinensern so etwa 20 Prozent des fruchtbaren Landes, trennt Dörfer von ihren Feldern, zerschneidet Wohngebiete, Gärten.
Die Mauer ist ein zirka acht Meter hohes Monstrum, Betonplatten, unterbrochen von Wachtürmen. Gegenwärtig ist noch an einer Stelle ein etwa fünf Meter breiter Streifen offen, durch den man auf die andere Seite blicken kann. Um einen kleinen Holzturm herum bewegen sich israelische Soldaten in Kampfmontur. Vor dem Wachturm, der auf palästinensischem Gebiet steht, befiehlt ein Schild in Hebräisch: "Private property, do not enter!"
Faten fragt mich: "Bald ist die Mauer ganz zu, kannst du dir vorstellen, wie uns zumute sein wird?" Allein traut sie sich dort kaum hin, sie fühlt sich sicherer, weil ich als Ausländerin dabei bin. Die Mauer haben von dieser Seite mexikanische Künstler bemalt. In Englisch steht da: "Existieren heißt widerstehen" und in Spanisch: "Es lebe ein freies Palästina, reißt die faschistische Mauer ein, es lebe die EZLN." (Die EZLN, das ist die Bewegung der Zapatistas in Mexiko.)
Das Gefühl, eingesperrt zu sein, keine Luft zu bekommen, befällt mich immer stärker. Tote Häuser, die Mauer, Wachtürme, Stacheldraht. Pete Seeger hat dem alten Woody-Guthrie-Lied "This land is your land, this land is my land" eine Strophe angehängt: "Nobody living can ever stop me, as I go walking my freedom highway, nobody living can make me turn back, this land was made for you and me."
Später fahren wir noch nach Beit Sahour. Dort ist die Mauer ein Zaun, durchsichtig zwar, aber genauso unüberwindlich: "Life danger, do not enter", steht da. Ein mehrere Meter breiter Streifen, NATO-Draht, Land, Zaun, Land, NATO-Draht, der Zaun verläuft in Schlangenlinien, sehr viel Land einnehmend, vom Berg in das Tal und wieder bergauf. Die Menschen sind wie gelähmt.
Neue Regierung
Die palästinensischen Kommunalwahlen sind vorbei. Eine ganze Reihe Frauen sind gewählt worden. Mahmud Abbas wurde Präsident. Zum ersten Mal seit Jahren gibt es Gespräche zwischen der palästinensischen und der israelischen Regierung. Condoleezza Rice besuchte als erste hochrangige US-Politikerin seit vielen Jahren Ramallah. Sind Hoffnungen realistisch, oder sind diese Schritte Teil der Vorbereitung eines möglichen US-Krieges gegen den Iran? Oder gegen Syrien? Palästina versinkt in Hoffnungslosigkeit, Wut und Lethargie. So leicht wird diese nicht zu überwinden sein, es sei denn, es entwickelten sich wirkliche Veränderungen. Zum Beispiel: Die Flüchtlinge dürfen nach Palästina zurückkehren. Die Palästinenser regeln ihre Wasserversorgung selbst. Die unmenschlichen Checkpoints werden geschlossen. Die Gefangenen kommen in großem Maßstab frei. Den Menschen wird ein Leben ermöglicht, in dem sie Arbeit haben, in dem die Kinder ohne Angst zur Schule gehen, sie sich frei bewegen können, die Straßen von allen benutzbar sind, die Gesundheitsversorgung entscheidend verbessert und die Mauer eingerissen wird.
Quelle: junge Welt vom 07.03.2005
Lesen Sie weitere interessante Artikel auf unserer
News-Seite Mehrere Maschinen landen nachts um drei gleichzeitig in Tel Aviv. Vergleichbare Prozeduren wie in den USA, Einreisekarten mit allen möglichen Fragen, endlose Schlangen vor den Schaltern, unfreundliche Beamte. Wohin, mit wem, warum alleine, usw. Israel hat 6,5 Millionen Einwohner, ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Das Pro-Kopf-Einkommen rangiert an 16. Stelle der Weltrangliste. Israel erhält 40 Prozent aller US-amerikanischen Auslandshilfe. Das waren in den letzten Jahren im Durchschnitt 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Zwei Lobbygruppen in den USA sorgen darüber hinaus für weitere Finanzhilfen: die zionistischen Organisationen und die christlichen Fundamentalisten, zu denen auch George W. Bush gehört. Nach ihren Vorstellungen wird der Messias wieder erscheinen, wenn alle Juden der Welt auf dem Gebiet des alten Palästina vereint sind. Von daher unterstützen sie die Siedlungspolitik.
Mehrere Maschinen landen nachts um drei gleichzeitig in Tel Aviv. Vergleichbare Prozeduren wie in den USA, Einreisekarten mit allen möglichen Fragen, endlose Schlangen vor den Schaltern, unfreundliche Beamte. Wohin, mit wem, warum alleine, usw. Israel hat 6,5 Millionen Einwohner, ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Das Pro-Kopf-Einkommen rangiert an 16. Stelle der Weltrangliste. Israel erhält 40 Prozent aller US-amerikanischen Auslandshilfe. Das waren in den letzten Jahren im Durchschnitt 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Zwei Lobbygruppen in den USA sorgen darüber hinaus für weitere Finanzhilfen: die zionistischen Organisationen und die christlichen Fundamentalisten, zu denen auch George W. Bush gehört. Nach ihren Vorstellungen wird der Messias wieder erscheinen, wenn alle Juden der Welt auf dem Gebiet des alten Palästina vereint sind. Von daher unterstützen sie die Siedlungspolitik.