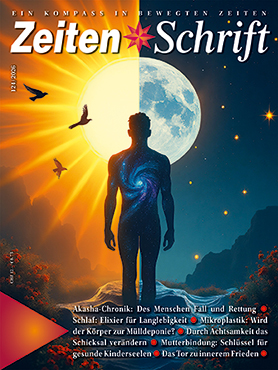Sie sind im News-Archiv der ZeitenSchrift gelandet.
Aktuelle Beiträge finden Sie im Bereich Aktuell.
Hey, Big Spender!
Von Thomas Fischermann
Fast 200 Laserdrucker. 500 Walkie-Talkies. Ballons und Konfetti für 250000 Dollar. 5000 Stellplätze in den umliegenden Parkhäusern. Am letzten Wochenende wurde in Boston der demokratische Präsidentschaftskandidat John Kerry nominiert, und das Spektakel gerät zur Materialschlacht. 95 Millionen Dollar soll es kosten, das wären zehn Millionen mehr als die entsprechende Veranstaltung vor vier Jahren in Los Angeles. George W. Bushs Konkurrenzparty in New York könnte Anfang September sogar noch um die Hälfte teurer werden.
Doch Bush und Kerry können es sich leisten, großzügige Gastgeber zu spielen. Private Spender unterstützen den Wahlkampf 2004 wie nie zuvor. Sie brechen dabei alle Rekorde - und das ganz ohne Scheu. Etliche Aktivistengruppen im Land sorgen sich schon um die Unabhängigkeit des nächsten Präsidenten. Welche Verpflichtungen gehen die Kandidaten ein? Ist die Spendenexplosion nicht ein Zeichen für die "Korruption der beiden Großparteien", wie der unabhängige Präsidentschaftsbewerber Ralph Nader wettert? Tatsache ist jedenfalls, dass der Zusammenhang von Geldfluss und politischer Gegenleistung immer offensichtlicher wird.
Monat für Monat verkünden beide Lager stolz ihre Kassenstände: John Kerry will 180 Millionen Dollar eingesammelt haben, Bush 218 Millionen. Indirekte Spenden an staatliche Parteiorganisationen oder an die Kongresse in Boston und New York sind da nicht mitgezählt und dürften diese Beträge noch einmal übertreffen. Dagegen verblassen die offiziellen Fördermittel von 75 Millionen Dollar pro Kandidat geradezu.
"Wir suchten Freunde, und wir haben einen gefunden", jubelte James Harless, ein Vorstandsmitglied der Firma Massey Energy, seinerzeit über den neuen Präsidenten George W. Bush. Seine Firma praktiziert in den USA eine umstrittene Methode der Kohleförderung: Massey holzt Wälder ab, sprengt dann ganze Bergspitzen mit Dynamit weg und kippt das Geröll in die umliegenden Täler und Gewässer. Umweltschützer gehen dagegen bis heute auf die Barrikaden, doch die Bush-Administration hatte nichts einzuwenden: Ein paar störende Wasserschutzgesetze wurden jedenfalls aus dem Weg geräumt. Das so genannte mountain topping gehört zu den Fällen, die die Umweltschutzorganisation Earthjustice aus Oakland in ihrem Report als paybacks - vermutete Rückzahlungen für frühere Spenden - bezeichnet. Die Bergbauindustrie hatte im Wahlkampf mindestens 3,1 Millionen Dollar an die Bush/Cheney-Kampagne überwiesen.
Auch die Holzindustrie gab 3,4 Millionen und darf seither mehr in Nationalparks abholzen, Kohlekraftwerkbetreiber stifteten zwei Millionen und erhielten laschere Luftschutzregeln. Laut der Washingtoner Aktivistengruppe Public Citizen "sind die größten Umweltverschmutzer zugleich auch die größten Parteispender" für republikanische Kandidaten. Gleich nach seinem Amtsantritt hatte Bushs Vizepräsident Dick Cheney eine Energiekommission ins Leben gerufen, die fast ausschließlich aus Großspendern der betroffenen Branchen bestand und einige Gesetzesvorlagen wörtlich aus den Vorlagen der Lobbyisten übernahm. Kann so etwas Zufall sein?
Im laufenden Wahlkampf 2004 zeichnen sich hingegen neue Trends ab. Die größte Spendergruppe ist der Finanzsektor. Seit Monaten schon liefern sich die Chefs einiger Großbanken einen Wettbewerb, wer das meiste Geld eintreiben kann: Stan O'Neil von Merrill Lynch etwa soll sein Topmanagement gleich mehrfach gedrängelt haben, Bush und Cheney große Schecks auszustellen. Die Zuneigung der Bankiers ist angebracht: Bush hat Senkungen der Dividenden-, Kapitalertrag- und einiger Vermögensteuern beschlossen - und die laufen in ein paar Jahren aus, wenn der Präsident sie nicht verlängert. Bush will auch das Rentensystem weiter privatiseren, ein möglicher Geldsegen für die Wall Street. "Bush hat den Zusammenhang zwischen Spenden und politischen Gefälligkeiten sehr deutlich werden lassen", sagt Alex Knott, Parteispendenforscher am Washingtoner Center for Public Integrity.
Doch auch seine Gegenspieler, John Kerry und John Edwards, sind vor solchen Abhängigkeiten nicht gefeit. Traditionell geben die Gewerkschaften bei demokratischen Kandidaten den Takt an: Im letzten Wahlkampf transferierten sie 175 Millionen Dollar an die Demokraten, plus Sach- und Personalhilfen, und auch in diesem Jahr hat die Partei die Gewerkschaften fest hinter sich. Im Gegenzug sind demokratische Präsidenten dafür bekannt, dass sie den Belangen traditioneller Industriezweige besondere Beachtung schenken, ihnen mit Subventionen und Schutzzöllen unter die Arme greifen.
Der Vizepräsidentschafts-Kandidat John Edwards bringt auch noch die Unterstützung einer anderen Milliardenbranche mit: der Klageanwälte. Edwards ist selbst als solcher reich geworden, seine Kandidatur wurde fast ausschließlich von Rechtsanwaltsfirmen finanziert, doch kaum eine Berufsgruppe ist in den Vereinigten Staaten so umstritten. Die von ihnen angestrengten Prozesse haben in den vergangenen Jahren bizarre Züge angenommen. Berühmt etwa wurde die Millionenklage gegen McDonald's, das angeblich zu heißen Kaffee ausschenkte. Wenn John Kerry und John Edwards die Wahl gewinnen, rechnet niemand mit einer durchgreifenden Justizreform.
Andere Unternehmen, etwa der Bierbrauer Anheuser-Busch und einige Banken an der Wall Street, spenden zugleich an Republikaner und Demokraten. Das sichert sie in beide Richtungen ab. Und treibt die Spendenrekorde in neue Höhe.
Ehrenzeichen für Großspender
Eigentlich hätte es die Gabenexplosion im Wahlkampf 2004 gar nicht geben sollen. Erst vor zwei Jahren unterschrieb Präsident Bush ein neues Parteispendengesetz, den Bipartisan Campaign Reform Act. Es sollte Schluss machen mit Millionenspenden und Korruptionsgefahr vor allem durch so genanntes soft money - sechs- und siebenstellige Dollar-Schecks von Unternehmen an Parteien, vorgeblich zum Zweck der "allgemeinen Parteiarbeit" oder "demokratischen Erziehung". Im Herzen stand Bush wahrscheinlich nicht hinter dieser Unterschrift. Noch am gleichen Vormittag flog er zu einer Party für reiche Parteispender aus South Carolina weiter. Und ohne zu zögern, machten sich Anwälten daran, Lücken und Umgehungsmöglichkeiten aufzutun.
Nun kann man es einem Präsidentschaftskandidaten kaum verdenken, wenn er sich um reiche Spender müht wie um keine andere Bevölkerungsgruppe. Der Weg ins Weiße Haus beginnt mit den so genannten wealth primaries: Lange vor der ersten demokratischen Abstimmung setzen Tausende reicher Amerikaner Geld auf einen Bewerber um die demokratische oder republikanische Spitzenkandidatur. Ihr Geld hat in der Vergangenheit meist entschieden. So war es bei Kerry und Edwards und einst bei Carter und Ford, Reagan und Mondale, Dudakis und Clinton.
Wahlkämpfe degenerieren zur Materialschlacht, weil talentierte Mitarbeiter immer stolzere Gehälter fordern. Dazu werden Fernsehwerbung und Hunderttausende Telefonanrufe in den kommenden Monaten die wichtigsten Kommunikationsmittel für die Kandidaten sein.
Dass die Spenden wirklich immer reichlicher fließen, hat vor allem mit einer Innovation zu tun, die George W. Bushs Team im Jahr 1999 in den Wahlkampf eingeführt hatte. Sein "Pioniersystem" half ihm, deutlich mehr Spenden einzutreiben als seine Widersacher. Bushs Wahlkampfstrategen wenden sich vertraulich an wohlhabende und gut vernetzte Anhänger. Solche "Pioniere" versprechen, im Bekannten-, Kollegen- oder Branchenkreis um weitere Spenden zu bitten und insgesamt 100000 Dollar einzusammeln. Ein penibles Buchhaltungssystem erfasst die Beträge und ordnet sie dem jeweiligen Pionier zu.
Die Sache klingt umständlich, doch sie ist "die erfolgreichste Spendenaktion in der Geschichte der Politik geworden", glaubt Craig McDonald, Chef der Aktivistengruppe Texans for Public Justice. Das Pioniersystem ist nämlich bestens mit dem neuen Parteispendengesetz vereinbar: Heute darf keine Einzelperson mehr als 2000 Dollar an eine Kampagne überweisen, aber das Sammeln und Bündeln ist erlaubt. Zweitens zapft das Verfahren die persönlichen Netzwerke einiger der reichsten Amerikaner an, und die sehen nicht selten ihren Ehrgeiz angestachelt. Zur Belohnung bekamen die "Pioniere" nach der letzten Wahl nicht nur den symbolischen Manschettenknopf mit dem Stern von Texas zugeschickt - sondern auch Sprechzeiten mit dem Präsidenten eingeräumt, Übernachtungen in Camp David eingerichtet, und einige fanden sich gar als Botschafter, Staatssekretäre oder Richter wieder. "Sorgen Sie dafür, dass unserer Branche Spenden gutgeschrieben werden" - solche und ähnliche Sprüche standen auf den Einladungen etlicher Parteispenden-Partys.
Der Anreiz ist offenbar attraktiv genug. Im diesjährigen Wahlkampf zählt die Bush-Kampagne bereits 300 Pioniere, mehr als 200 "Rangers" (ab 200000 Dollar) und mehr als 60 "Super-Rangers" (ab 300000 Dollar). Die Kerry-Kampagne hat mit einem ähnlichen System nachgezogen und zählte im Juni 298 "Co-Chairs" (ab 50000 Dollar) und 266 "Vice Chairs" (ab 100000 Dollar). Sogar eine Reihe Washingtoner Karrierepolitiker oder hochrangiger Mitglieder der Administration hat sich als Pioniere oder Vice Chairs angemeldet. "Auf diese Weise hilft man seiner Partei - und empfiehlt sich für einen Job nach der Wahl", erzählt ein Washingtoner Lobbyist.
Konservative Milliardäre gesucht
Klassische sechs- und siebenstellige Dollar-Schecks werden auch in diesem Wahlkampf noch ausgestellt. Wegen des neuen Parteispendengesetzes muss es freilich indirekter geschehen: Als Schlupfloch haben sich scheinbar "unabhängige" Organisationen erwiesen, die illustre Namen wie MoveOn, Media Fund oder Americans for a Better Country tragen. Einige von ihnen haben in den vergangenen Wochen mehr Fernsehspots ausgestrahlt als beide Kandidaten zusammen ("Feuert Rumsfeld!"). Die Milliardäre George Soros, Peter Lewis und Linda Pritzker zum Beispiel haben sich dem Sturz George W. Bushs verschrieben und Millionenschecks an solche Organisationen ausgestellt. Republikanische Spendensammler suchen fieberhaft nach konservativer gesinnten Milliardären.
Und dann sind da noch die Parteikongresse in Boston und New York, für die US-Unternehmen unbegrenzt spenden dürfen. Am kommenden Wochenende sind rings um Boston schon 200 Partys und Empfänge angemeldet - mehr als in den Vorjahren. Bei zwei Dritteln davon haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Nicht mehr Politiker laden ein, sondern Unternehmen: die AIG-Versicherungsgruppe ins Nobelrestaurant Locke-Ober, der biotechnische Industrieverband zu einem Empfang im Wissenschaftsmuseum und die American Gas Association in einen Nachtclub.
Quelle: DIE ZEIT