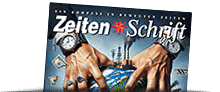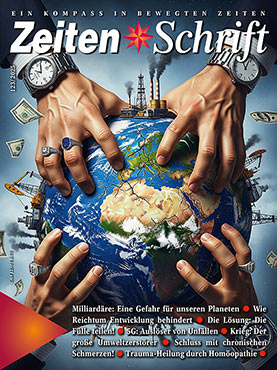Drei Landwirte, Jakob Neyer aus Österreich, Romuald Schaber aus Deutschland und Hans Stalder aus der Schweiz machten mit ihrem gemeinsamen Vortrag, den sie am XII. Kongress "Mut zur Ethik" in Feldkirch (Vorarlberg) hielten, auf die Situation der Landwirtschaft in ihren Ländern aufmerksam.
EU-Propaganda und EU-Realität (Romuald Schaber)

Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen versuchen, aus Sicht der Landwirtschaft einen bescheidenen Beitrag zu leisten zum Thema "Werte leben in unserer Zeit". In der EU vollzieht sich in der Landwirtschaft zurzeit ein ungeheurer Wandel. Ich möchte einen kurzen Überblick über die Situation in der EU geben. Sehr wichtig ist hierbei für uns die Tatsache, dass die Realitäten nicht mit der durch die EU-Kommission verbreiteten Darstellung übereinstimmen. Ich möchte dazu ein paar Beispiele nennen:
Agrarkommissar Fischler hat im Zuge der neuen Reform verkündet, dass die Landwirtschaft in Europa mit der Gesellschaft versöhnt werden solle. Er hat gesagt, es komme darauf an, mehr Umweltschutz zu gewährleisten, es komme darauf an, mehr Tierschutz umzusetzen, mehr Markt, mehr Unternehmertum solle Einzug halten. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wird gefordert, dass die europäischen Bauern weltweit in Wettbewerb zu ihren Kollegen treten sollen. So die EU-Propaganda.
Die Realität ist, dass die Erzeugerpreise immer weiter sinken. Der Weltmarkt wird zunehmend manipuliert: Obwohl die Getreidevorräte ständig sinken, sind die Erzeugerpreise derzeit in der EU auf einem historisch niedrigen Niveau. Für Roggen werden beispielsweise nur noch 6 Euro bezahlt. Die Produktionskosten liegen aber weit darüber. International versuchen ganz wenige Konzerne, sich den Ernährungssektor unter den Nagel zu reissen. Durch die Gentechnik soll die völlige Kontrolle über Saatgut, über Düngung und über den Pflanzenschutz gewonnen werden.
Die realen Auswirkungen sind in der europäischen Landwirtschaft, auch in Deutschland, folgende: Die Betriebe werden immer grösser; im Durchschnitt verdoppelt sich die Betriebsgrösse alle 10 Jahre, das heisst im Umkehrschluss, dass sich alle 10 Jahre die Zahl der Betriebe halbiert. Umwelt- und Tierschutz werden unter diesen Umständen mit Sicherheit nicht verbessert. Und das ganz Entscheidende, was unser Thema hier ist, auch die gesellschaftliche Einbindung der Bauern geht weitgehend verloren. Früher gab es pro Dorf, pro Ortschaft 5 oder 10 Betriebe. Heute kommt auf 2 Dörfer 1 Landwirtschaftsbetrieb. Es gibt viele Dörfer in Deutschland, die keinen landwirtschaftlichen Betrieb mehr beheimaten. Früher wurde das kulturelle Leben stark von den Bauern geprägt. Der ganze Ablauf des kulturellen Lebens wurde von der Landwirtschaft und den darin tätigen Menschen geprägt. Die konservative Grundhaltung der Bauern war das Rückgrat der Gesellschaft. Heute können wir sagen: Je grösser die Betriebe werden, desto stärker werden die Leute ausgegrenzt, die in der Landwirtschaft arbeiten.
Wir stellen fest, dass viele in der Arbeitsfalle gefangen sind. Wenn pro Person 3000 Stunden oder noch mehr gearbeitet werden sollen, bleibt für soziale, gesellschaftliche Aktivitäten sehr wenig Zeit. Die Betriebe werden sozial immer instabiler, was sich in zunehmenden Ehekrisen ausdrückt. Wenn die Entwicklung in der EU so weitergeht, können wir uns folgendes Szenario vorstellen: Das eine Beispiel sind die USA, das andere Ostdeutschland, die ehemalige DDR. Aber auch die sogenannten Fremdarbeitsbetriebe leisten kaum einen Beitrag zum kulturellen Leben. Wo nur ein verantwortlicher Betriebsleiter für 20 oder 30 Angestellte zuständig ist, die dann im Schichtbetrieb arbeiten, ist es sehr schwer, sich im kulturellen und im öffentlichen Leben zu betätigen.
Was ist zu tun? Ich denke, wir alle, die ganze Gesellschaft, müssen uns darüber klar werden, was wir wollen. Wo soll die Reise hingehen? Wir alle sind aufgerufen, uns Gedanken zu machen und nicht nur der oberflächlichen Propaganda der Politik hinterherzulaufen. Wenn die Bauern weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten sollen, muss das Ruder herumgerissen werden. Es ist 5 vor 12, wenn nicht schon 12 Uhr. Packen wir's an!
Woher kommt der Preisdruck auf landwirtschaftliche Produkte? (Jakob Neyer)
Wieso ich hier spreche? Es muss ja einen Sinn haben, wenn ich hierher komme und etwas über die österreichische Landwirtschaft und die Agrarpolitik sage, denn unser aller Zeit ist sehr kostbar. Aber es ist auch für Sie sehr wichtig, wenn ich in Ergänzung zu meinem Vorredner einige Punkte zu diesem Thema sage.
Die Bauern haben mit einem gewaltigen Einkommensrückgang zu kämpfen. Wir setzen uns für gerechte Preise ein. Dabei müssen wir uns die Frage stellen: Woher kommt der massive Preisdruck auf die landwirtschaftlichen Produkte? Dazu möchte ich drei Punkte anführen:
Ein erster Faktor ist der Konsument. Wir sind alle Konsumenten. Sie sind Konsumenten verschiedenster Berufsgruppen, und es ist positiv, dass wir Gelegenheit haben, zu Ihnen zu sprechen. In Österreich ist der Konsument bereit, gerade 12 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel auszugeben. Um diese 12 Prozent streiten sich in dieser Wertschöpfungskette der Landwirt, der Verarbeiter und der Handel, der Discounter. Hier herrscht ein letaler Wettbewerb. Auch qualitativ hochwertige Produkte werden von Handelsketten zu Kampfpreisen angeboten und verkauft. Bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln herrscht ein Preisdumping, daher ein Teil des Drucks, dem die bäuerlichen Produkte unterliegen.
Der zweite Faktor ist die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union. Sie setzt vielfach auf Überproduktion, was nicht nachvollziehbar ist. Bei der Milch zum Beispiel haben wir einen strukturellen Überschuss von etwa 20 Prozent, wodurch der bäuerliche Milchpreis einem Dauerdruck nach unten ausgesetzt ist.
Der dritte, ganz wichtige Faktor ist die Lüge vom freien Markt. Ich muss das so betonen, weil immer vom freien Markt bzw. vom freien Weltmarkt gesprochen wird. Es gibt keinen freien Weltmarkt. Am freien Markt gälten für alle dieselben Spielregeln. Das gibt es eben nicht. Ich sage, das ist eine Lüge. Da wird uns etwas vorgemacht. Wir haben die billigsten Produktionsländer der ganzen Welt vor der Haustür. Die Produktion - auch die der Grundnahrungsmittel - wird auf jene Kontinente und in jene Länder verlegt, in denen die Arbeitskosten am billigsten sind und - das betrifft die Landwirtschaft ganz besonders - die Umweltauflagen am laschesten. Aber als gravierendster Punkt kommt dazu, dass die Transportkosten absolut nicht so gerechnet werden, wie sie eigentlich gerechnet werden müssten. Paradoxerweise ist ein Produkt um so billiger, je weiter ich es im globalen System transportiere. Die billigsten Produkte in unseren Regalen - Sie können das prüfen - kommen aus den entferntesten Ländern. Wir haben Äpfel aus Thailand, die billiger sind als unsere Äpfel; Tomaten aus Kalifornien und Rindfleisch aus Argentinien - alles billiger als bei uns. Das heisst nichts anderes als: Der globale Verkehr ist versteckt subventioniert, und zwar weit, weit mehr als die Landwirtschaft bei uns in Europa.
Das richtet uns zugrunde. Hierin liegt einer der gewichtigsten Gründe, wieso der heimische Bauer einem solchen Wettbewerb ausgesetzt ist. Hier müssen wir den Hebel ansetzen. In allen Gremien, in denen ich sitze und mitarbeite, mache ich auf diese Situation aufmerksam und mache es zum Thema. Ich schreibe Anträge, Resolutionen, und allmählich registriere ich Resonanz. Wenn wir das nicht thematisieren, führen wir einen Kampf vergleichbar dem Wettlauf des Hasen mit dem Igel: Wir laufen wie die Hasen und gehen daran zugrunde, die anderen lachen sich ins Fäustchen, weil sie immer schon vor uns da sind.
Wir haben aber noch ein anderes Problem. Zum einen ist das Einkommen in den letzten Jahren 3 bis 4 Prozent zurückgegangen. Dazu kommt aber noch, dass wir immer abhängiger werden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Bauer wie ein Drogenabhängiger leben muss: Die Prämie, die öffentlichen Mittel, sind die Drogen für den Bauern. Werden sie einmal abgestellt, dann weiss ich nicht, wie viele Existenzen dadurch von heute auf morgen zugrunde gerichtet werden.
Wie ist diese Abhängigkeit zustande gekommen? 1986, vor rund 20 Jahren, bezogen die Bauern bei der Einkommensbildung etwa 10 Prozent aus öffentlichen Mitteln. 1994, kurz vor unserem EU-Beitritt, lag die Quote etwa bei einem Drittel. 1995, nach unserem Beitritt, ist die Abhängigkeit rasant gestiegen: Sie stieg auf zwei Drittel des Einkommens. Wenn man heute den Abschluss des vergangenen Jahres anschaut, haben wir bereits Betriebe, die 90 Prozent ihres Gesamteinkommens aus öffentlichen Mitteln beziehen. Das ist diese letale Abhängigkeit. Und hier wollen wir natürlich den Hebel ansetzen.
Die Erwartungshaltung der Konsumenten - und die Konsumentenvertretung in Österreich ist sehr gross - muss für die Landwirte oberste Priorität haben, um die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel zu gewährleisten. Das wird erwartet, aber das kann es nicht zum Nulltarif geben. Hier braucht es die Einsicht, dass die Arbeit der Bauern auch gerecht bezahlt werden muss. Das ist für mich eine Vision, von der wir noch weit entfernt sind. Die sogenannte Agrarreform der EU 2003 wird dazu führen - und ich wage es, das vorauszusagen -, dass das gesamte Ökosystem des Alpenraumes aus dem Gleichgewicht gerät.
Die Milchproduktion hat über viele Jahrhunderte den Alpenraum, die Grünfläche und den Wald, natürlich in der Obhut des Bauern, gestaltet. Wir haben heute in Österreich 13,5 Hektar Zuwachs von Verbuschung und Verwaldung, pro Tag 13,5 Hektar. Das geht in manchen Talschaften unheimlich rasant vor sich. Das hat neben der Landwirtschaft auch Auswirkungen auf andere Berufssparten, zum Beispiel den Tourismus. Es ist erwiesen, dass sich der Charakter einer Talschaft, einer Region total verändert, wenn sich das Verhältnis von 60 Prozent Wiesenfläche zu 40 Prozent Wald umkehrt. Bereits bei einem Verhältnis von 50 zu 50 ist der Charakter der Landschaft so verändert, dass sowohl der auswärtige als auch der einheimische Tourist ausbleiben wird. Wir haben deshalb auch eine sehr starke Entsiedelung in mancher Talschaft in Österreich. Und hier sitzen wir in einem Boot. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Abschliessend möchte ich nur nochmal betonen: Wir kämpfen für gerechte Preise. Den Bauern werden diese schon jahrzehntelang vorenthalten. Wir sind heute hier, um Ihnen das zu sagen. Sie kommen aus allen möglichen Berufsgruppen, und wir bitten Sie, das hinauszutragen. Wenn Lehrpersonen unter Ihnen sind, dann sagen Sie das Ihren Schülern. Lebensmittel, die Qualität haben, die Sicherheit bieten, das ist eine Investition für die Zukunft und somit für die Volksgesundheit. Und beim Einkauf schauen Sie bitte, woher die Lebensmittel kommen und boykottieren Sie diejenigen, die Zehntausende von Kilometern zurückgelegt haben. So hat der Konsument die Möglichkeit, mit beizutragen. So kann der Konsument die Politik beeinflussen. Wir sind auf die Partnerschaft mit den Konsumenten angewiesen. Das sollte allen klar werden.
Kultivierung des Landes durch den Bauernstand (Hans Stalder)
Es waren die Bauern, die den Boden kultivierten. Sie rodeten Buschwerk und Wald, wie wir eben von Jakob Neyer gehört haben, legten Wiesen und Äcker an, züchteten Nutztiere und konnten somit die Grundlage schaffen, dass wir Menschen - gerade auch in kargen Gegenden, wie wir es eben in den Alpenländern vorfinden - sesshaft werden konnten. Aber gerade diese beschwerlichen Umstände zwangen die Bauern dazu, gemeinsam die schwierigen Aufgaben zu lösen: wilde Bergbäche zu zähmen, Strassen und Wege anzulegen, nicht zuletzt gemeinsam gegen Banditentum zu kämpfen oder sich gegen Wildtiere zu verteidigen. Das Motto hiess: Einigkeit macht stark. Bauern waren es, besonders auch in der Schweiz, die die Politik zu kultivieren versuchten, in dem sie die Vögte vertrieben und versuchten, die Demokratie zu installieren, zu beleben und ständig zu verfeinern. Doch was geschieht heute mit unserer Landwirtschaft? Man brauche sie nicht mehr, predigen Wirtschaftsbosse und einflussreiche Politiker. Wir hören das immer wieder, wir Bauern seien eine Minderheit geworden und offenbar für die Öffentlichkeit eine Last. Nur noch Grossbetriebe mit wenigen Angestellten - sogenannte industrielle Landwirtschaft - werden nun mit allen Mitteln erzwungen. Selbst Bauernpolitiker von rechts bis links sehen das Heil in der industriellen Landwirtschaft, obwohl schon längst bewiesen ist, dass die industrielle Landwirtschaft ein gewaltiger Irrweg ist. Die bäuerliche Kultur ist in Gefahr. Warum? Es gibt immer weniger Nachfahren, immer weniger Junge wollen den Beruf des Bauern/der Bäuerin erlernen. Der Familienbetrieb kommt immer mehr in Bedrängnis, sowohl finanziell als auch sozial. Aber auch die kulturellen Aktivitäten in den Bauernfamilien können immer weniger gepflegt werden. Ist das nicht verwunderlich? Kultur ist nicht nur Volksmusik, die ich übrigens sehr schätze. Sie umfasst das Wissen über verschiedene Sachgebiete. Ich könnte jetzt 2 Stunden lang über Sachgebiete sprechen, die grossen Einfluss auf die Umwelt und auf uns Menschen haben. Aber gestatten Sie mir, noch zwei, drei Beispiele hier darzulegen.
Mit wenig Geldaufwand wurden grosse Umweltprobleme gelöst, zum Beispiel das Erstellen von Bach- und Flussverbauungen. Über Generationen haben Bauern, aber auch Dorfbewohner mit einfachsten Mitteln diese Probleme gemeistert. Selbstverständlich gab es immer auch Katastrophen, wie wir sie heute auch kennen, aber man hatte nicht die Mittel, um das zu beheben. Eine weitere Katastrophe bahnt sich an oder hat sich schon angebahnt. Es ist der Borkenkäfer. Die Bauern wussten, wie mit den Wäldern umzugehen ist. Heute haben wir Gelehrte, die den Bauern Vorschriften machen: "Das müsst ihr nicht, das dürft ihr nicht, das sollt ihr nicht."
Das Resultat dieser Vorschriften sind riesige Borkenkäferepedemien, und zwar nur, weil den Bauern verboten wird, das Grünzeug, sobald eine Tanne befallen ist, blitzschnell zu roden, die Äste zu verbrennen, damit die Larven schadlos gemacht werden können. Angeblich sei die Umweltverschmutzung dabei das grösste Problem, weil wir im Rauch ersticken könnten. Wenn aber die Wälder abgefressen respektive vernichtet werden und ganze Schutzlawinenhänge kahl sind, ist das das grössere Übel. Ein ganzheitliches Betrachten der Dinge, das können und konnten viele Bauern noch. So funktioniert der ländliche Raum. Ich denke dabei ans Gemeinwesen, Gemeindewesen, aber auch das wird wegrationalisiert beziehungsweise -organisiert. Viele Amtsleute und Politiker haben in einer kleinen Gemeinde begonnen, wo sie sich einarbeiten und später in höhere Positionen gebracht werden konnten. Nicht zuletzt waren es immer wieder Leute aus dem ländlichen Raum, Bauern, die Grossartiges geleistet haben. Ich denke an unseren General Guisan, der eigentlich der richtige Mann war, er war ein Bauer.
Was kann das soziale Verhalten der Bauern eigentlich bewirken? Früher waren es Verdingkinder und Waisen, die bei den Bauern aufgenommen wurden. Wohlverstanden, man hört zum Teil grausige Geschichten von Verdingkindern, die zum Teil leider wahr sind. Es gibt aber viel mehr Beispiele, wo Verdingkinder gut aufgenommen wurden, wo Waisen aufgenommen wurden, bestens bewirtet beziehungsweise gehalten wurden wie die eigenen Kinder. Heute sind es Drogenabhängige, die den Bauern zugewiesen werden, selbstverständlich nicht unter Zwang, aber die Unterstützungsgelder für den Bauern sind mangelhaft bis dürftig. Sie betragen oft kaum die Hälfte vom dem, was sonst für Drogenabhängige bezahlt wird.
Über bäuerliches Bauen, Wohnhäuser aus Holz und Lehm haben sich viele "gescheite" Leute lustig gemacht. Heute erkennen wir den Wert. Bäuerliches Bauen, Bauen mit Holz, aber auch mit Lehm kommt wieder in Mode, und man sieht den Wert darin. Bergställe zum Beispiel, waren früher eher dunkel und von den Studierten als Höhlen bezeichnet worden, als unsinnig, als schlecht. Heute werden grosse Ställe gebaut. Man bietet zum Beispiel Schweinen einen Offenstall an mit genügend Streu, parallel dazu aber auch Erdställe. Und siehe da, wo fühlt sich das Schwein wohl, es geht in die Erdlöcher oder eben in Bodennähe. Es war nicht alles ganz so dumm, was man den dummen Bauern nachgesagt beziehungsweise angelastet hat. Neueste Erkenntnisse kommen oft darauf zurück, was die Bauern längst wussten. Warum mussten wir das alles eigentlich hinnehmen und auf unserem Buckel tragen? Ich frage mich, warum müssen wir uns von den gescheiten Leuten zum Beispiel in der EU diktieren lassen, was wir zu tun haben? Wir wissen es! Wir wissen haargenau, was Tierschutz ist. Wir wissen, wenn es dem Tier gut geht, dann geht es auch dem Bauern gut.
Quelle: Zeit-Fragen Nr.37
Lesen Sie weitere interessante Artikel auf unserer
News-Seite Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen versuchen, aus Sicht der Landwirtschaft einen bescheidenen Beitrag zu leisten zum Thema "Werte leben in unserer Zeit". In der EU vollzieht sich in der Landwirtschaft zurzeit ein ungeheurer Wandel. Ich möchte einen kurzen Überblick über die Situation in der EU geben. Sehr wichtig ist hierbei für uns die Tatsache, dass die Realitäten nicht mit der durch die EU-Kommission verbreiteten Darstellung übereinstimmen. Ich möchte dazu ein paar Beispiele nennen:
Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen versuchen, aus Sicht der Landwirtschaft einen bescheidenen Beitrag zu leisten zum Thema "Werte leben in unserer Zeit". In der EU vollzieht sich in der Landwirtschaft zurzeit ein ungeheurer Wandel. Ich möchte einen kurzen Überblick über die Situation in der EU geben. Sehr wichtig ist hierbei für uns die Tatsache, dass die Realitäten nicht mit der durch die EU-Kommission verbreiteten Darstellung übereinstimmen. Ich möchte dazu ein paar Beispiele nennen: