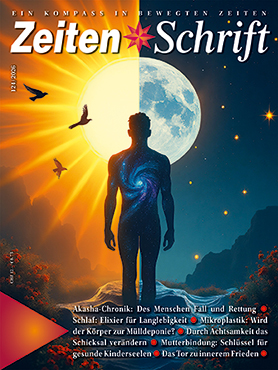Sie sind im News-Archiv der ZeitenSchrift gelandet.
Aktuelle Beiträge finden Sie im Bereich Aktuell.
In-vitro-Fertilisation: Roulette in der Retorte
 Kinder mit dem so genannten Angelman-Syndrom wirken auf den ersten Blick heiter. Sie lachen häufig und scheinbar unmotiviert, gelten deshalb auch als glückliche Puppen. Tatsächlich leiden sie jedoch meist unter schweren Fehlentwicklungen. Sie haben fortschreitende Krampfanfälle, sind geistig behindert und lernen nicht sprechen. Die Krankheit, die vor Ablauf des ersten Lebensjahres kaum auffällt, ist selten. Eine bestimmte Variante des Angelman-Syndroms kommt sogar nur etwa einmal auf 375000 Geburten vor. Umso überraschter waren Humangenetiker, als sie eine Häufung von gleich drei Angelman-Fällen dieser Art entdeckten – zwei davon in Deutschland – und feststellten, dass alle Kinder durch künstliche Befruchtung zur Welt gekommen waren.
Kinder mit dem so genannten Angelman-Syndrom wirken auf den ersten Blick heiter. Sie lachen häufig und scheinbar unmotiviert, gelten deshalb auch als glückliche Puppen. Tatsächlich leiden sie jedoch meist unter schweren Fehlentwicklungen. Sie haben fortschreitende Krampfanfälle, sind geistig behindert und lernen nicht sprechen. Die Krankheit, die vor Ablauf des ersten Lebensjahres kaum auffällt, ist selten. Eine bestimmte Variante des Angelman-Syndroms kommt sogar nur etwa einmal auf 375000 Geburten vor. Umso überraschter waren Humangenetiker, als sie eine Häufung von gleich drei Angelman-Fällen dieser Art entdeckten – zwei davon in Deutschland – und feststellten, dass alle Kinder durch künstliche Befruchtung zur Welt gekommen waren.
Selten ist auch das Beckwith-Wiedemann-Syndrom, durchschnittlich kommt ein Fall auf etwa 12000 Geburten. Die Babys leiden unter Riesenwuchs, der zu vergrößerten Organen und erhöhter Tumoranfälligkeit führt. Im vergangenen Jahr stellten Mediziner in den USA, in Großbritannien und Frankreich fest, dass in allen drei Ländern auffällig viele Babys mit Beckwith-Wiedemann-Syndrom im Labor gezeugt wurden. Insgesamt wurden 19 riesenwüchsige Babys nach In-vitro-Fertilisation (IVF) oder künstlicher Injektion eines Spermiums ins Ei (ICSI) entdeckt. Statistisch zu erwarten wären etwa fünf Fälle.
Seltene Defekte als Alarmsignal
Sind dies erste Anzeichen für möglicherweise fatale Konsequenzen der künstlichen Befruchtung? Gewiss lässt sich mit so geringen Zahlen keine seriöse Statistik betreiben. Zu Recht verweisen die Verfechter der In-vitro-Fertilisation auf ein Vierteljahrhundert Erfahrung und mehr als eine Million überwiegend gesunde Menschen, die dieser Technik ihr Leben verdanken. Dennoch werten Reproduktionsmediziner und Genetiker die seltenen Fälle als Alarmsignal. Sie befürchten, dass bei künstlichen Befruchtungen mehr schief gehen könnte als bisher angenommen.
"Mehrere innerhalb kürzester Zeit publizierte Beobachtungen lassen es nun möglich erscheinen, dass spezifische (…) angeborene Syndrome nach IVF und ICSI vermehrt auftreten", heißt es in einem Übersichtsartikel im Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, dem offiziellen Organ von acht Fachgesellschaften. Die jetzt beobachteten Fehlbildungen seien "möglicherweise nur die Spitze des Eisberges".
Als Ursache gelten nicht etwa klassische Erbgutschäden durch die künstliche Befruchtung, sondern so genannte Imprinting-Defekte. Soll heißen: Die Steuerung beziehungsweise Prägung ("Imprinting") der Gene läuft falsch. Denn für eine gedeihliche Entwicklung neuen Lebens müssen zahlreiche Gene wie die Instrumente eines riesigen Orchesters zeitlich präzise an- und ausgeschaltet werden – sonst entstehen Fehlbildungen, die tödlich sein können. Epigenetik ("Übergenetik") heißt der relativ junge Forschungszweig, der sich damit befasst. Es zeigt sich, dass fast alle Gene in der frühen embryonalen Entwicklung an- und ausgeschaltet werden – und dass Embryonen in dieser Phase deshalb äußerst empfindlich sind.
Darauf weist auch der Tiermediziner Heiner Niemann vom Institut für Tierzucht in Mariensee bei Hannover hin. Er warnt schon seit Jahren, dass die künstliche Befruchtung außerhalb des Mutterleibs Imprinting-Defekte verursachen kann. "Für uns ist es schlüssig, dass assistierte Reproduktionstechniken bei Mensch und Tier Nebenwirkungen haben", sagt Niemann. Als Hauptgrund nennt er die künstlichen Bedingungen, unter denen der Embryo mehrere Tage lang in vitro heranreift, bevor er in den Mutterleib verpflanzt wird. "In natürlicher Umgebung gibt es einen steten Austausch und Wechsel von Nähr- und Signalstoffen zwischen Mutter und Embryo." In der Kulturschale hingegen schwappt der Embryo immer in derselben Flüssigkeit, und falls diese gewechselt wird, kann das mehr schaden als nützen.
Niemann konnte an Rindern studieren, was beim Menschen undenkbar wäre: "Wir haben Embryonen unter möglichst gleichen Bedingungen erzeugt, gleiches Alter, gleicher Bullensamen et cetera. Dann haben wir gemessen, wie sich die Aktivität der Gene in natürlicher Umgebung, in utero, unterscheidet von den Genaktivitäten in vitro. Dabei haben wir erhebliche Unterschiede für fast jedes gemessene Gen festgestellt."
Dass die Kultur in vitro einen starken Einfluss auf die embryonale Entwicklung auch bei Mäusen und anderen Säugetieren haben können, bestätigt Hans Schöler, neu berufener Direktor am Max-Planck-Institut für Molekulare Biomedizin in Münster. "Da kann schon das Öffnen des Brutschranks einen Effekt haben", warnt er. Selbst harmlose Nährstoffe, die man zum Züchten von Mausembryonen in vitro zugesetzt hatte, können fatale Folgen haben.
Als im vergangenen Jahr dann auch noch fünf Fälle eines Imprinting-bedingten und normalerweise seltenen bösartigen Tumors im Auge (Retinoblastom) bei Kindern nach IVF und ICSI bekannt wurden, wuchs die Unruhe bei den Medizinern. Gemäß dem Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie sind Imprinting-Defekte "verantwortlich für eine Vielzahl seltener und teilweise spätmanifestierender Erkrankungen beim Menschen". Nüchtern heißt es dazu: "Auch 25 Jahre nach der Geburt des ersten durch IVF entstandenen Kindes liegen keine ausreichenden Studien zur Abschätzung eines möglichen epigenetischen Risikos durch IVF/ICSI vor."
Wie kann es passieren, dass nach über einer Million Geburten die In-vitro-Fertilisation erneut auf den Prüfstand muss, dass eventuell eine Vielzahl seltener, IVF-bedingter Leiden übersehen wurde? Vor allem zwei Faktoren sind ausschlaggebend: Erstens umfassten die meisten Studien zu wenige Fälle, um die vielen seltenen Defekte überhaupt zu entdecken, und sie beschränkten sich nur auf einen kurzen Zeitraum nach der Geburt. Zweitens verstehen Wissenschaftler erst jetzt, wie Imprinting-Defekte entstehen und wie sie aussehen könnten.
Wie wichtig das korrekte Zusammenspiel der Gene für die Entwicklung eines Embryos ist, zeigt sich drastisch beim Klonen von Tieren. Geklonte Embryonen enthalten zwar alle Gene, dennoch sterben sie meist frühzeitig ab – wegen Imprinting-Defekten. Kommt nach vielen Fehlversuchen schließlich ein Klontier zur Welt, dann hat es oft kein normales Gewicht. Es ist entweder unter- oder übergewichtig, leidet zudem an diffusen Erkrankungen etwa der Nerven oder des Kreislaufs oder gar an Krebs.
Wie können solch gegensätzliche Effekte entstehen, hier Untergewicht, da Übergewicht, wieso produzieren Klonen und IVF ähnliche Schadensmuster? Der Humangenetiker Thomas Haaf von der Universität Mainz erklärt die seltsamen Effekte mit einem "Geschlechterkonflikt im frühen Embryo". Die Schulweisheit, das Erbgut mütterlicher und väterlicher Herkunft sei weitgehend gleichwertig, war offenbar falsch. Vielmehr ringen im Embryo Erbmerkmale beider Geschlechter miteinander nach folgendem groben Muster: Väterliche Gene versuchen, das Wachstum des Embryos zu steigern, ohne Rücksicht auf die Mutter. Mütterliche Gene hingegen bremsen das embryonale Wachstum, um die Ressourcen der Frau zu schonen. In diesem Konflikt sitzen die Väter am kürzeren Hebel, denn die Eizelle verfügt über die Werkzeuge, mit denen sich Gene an- und ausschalten lassen. "Zu keinem anderen Zeitpunkt in der Entwicklung ist die Epigenetik eines Individuums so anfällig gegenüber der Umwelt", konstatiert Haaf.
Der Geschlechterkonflikt macht verständlich, warum das Klonen ein Chaos auslöst: Die Eizelle wird ihres eigenen mütterlichen Erbguts beraubt. Statt männlichem Erbgut wird ihr das alte Genmaterial einer Körperzelle untergejubelt. Die geklonte Eizelle "weiß" gar nicht, welches Erbgut männlichen und welches weiblichen Ursprungs ist und reprogrammiert blind drauflos. Das Resultat sind meist katastrophale Imprinting-Defekte, der geklonte Embryo stirbt. Wächst ein Klon dennoch heran und dominieren zufällig väterlich programmierte Gene, dann entsteht ein Riesenfötus mit Übergewicht. Large-Offspring-Syndrome ("Groß-Nachwuchs-Syndrom") heißt das Phänomen, das durch das Klonen von Tieren erst richtig auffällig wurde. Dominieren hingegen weiblich geprägte Gene, dann entsteht untergewichtiger Nachwuchs, der an allerlei Schwächen leidet oder gar stirbt.
Mal Unter-, mal Übergewicht, das ist beim Klonen fast die Regel. Offenbar kann aber auch schon die Befruchtung im Reagenzglas das Imprinting stören und dadurch die Balance im Geschlechterkonflikt. Auch nach IVF kommen vermehrt unter- beziehungsweise übergewichtige Tiere zur Welt, jedoch deutlich seltener als beim Klonen.
Ergebnisse von Tierexperimenten lassen sich nur begrenzt auf Menschen übertragen, doch bei der In-vitro-Fertilisation ergeben sich bemerkenswerte Parallelen: "Das erniedrigte Geburtsgewicht bei künstlicher Befruchtung passt gut zu einer Fehlregulation von geprägten Genen", schreibt der Humangenetiker Thomas Haaf im Deutschen Ärzteblatt. Auch das Large-Offspring-Syndrom bei Tieren erinnere an den Riesenwuchs, der beim Beckwith-Wiedemann-Syndrom auftritt. Nach IVF oder ICSI geborene Babys sind auffallend oft untergewichtig, gemäß einer sorgfältigen Studie im New England Journal of Medicine etwa 2,6-mal häufiger als nach natürlicher Empfängnis.
Bisher erklären die meisten Reproduktionsmediziner das Phänomen mit den Fruchtbarkeitsstörungen des Paares. So seien Mütter, die IVF oder ICSI in Anspruch nehmen, meist deutlich älter als der Durchschnitt, hinzu kämen mögliche hormonelle oder genetische Faktoren. Diese Ansicht vertritt beispielsweise Michael Ludwig. Der 36-jährige Gynäkologe hat eine der größten Studien über Fehlbildungen nach IVF und ICSI publiziert, er lehrt an der Medizinischen Universität Lübeck und praktiziert in Hamburg am Endokrinologikum. Ludwig verweist auf Untersuchungen, wonach in vitro gezeugte Kinder deutlich seltener untergewichtig sind, wenn sie von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Ein kleinerer Teil des Untergewichts, konzediert Ludwig, könnte auch auf Imprinting-Störungen zurückgehen. Dabei sei noch offen, ob dies auf die In-vitro-Kultur oder auf die genetische Disposition der Eltern zurückgehe.
Weitgehend Einigkeit herrscht darüber, dass generell die Rate angeborener Fehlbildungen bei Neugeborenen nach IVF und ICSI merklich höher liegt als nach natürlicher Fortpflanzung. So fand Ludwig in seiner deutschen Studie bei 8,6 Prozent der Schwangerschaften große Fehlbildungen nach ICSI, in der Kontrollgruppe natürlicher Schwangerschaften hingegen nur 6,9 Prozent. Das entspricht einem um 25 Prozent erhöhten, relativen Risiko. Eine australische Studie hingegen fand sogar eine verdoppelte Fehlbildungsrate nach IVF (9 Prozent) und ICSI (8,6 Prozent), verglichen mit dem "natürlichen" Vergleichskollektiv (4,2 Prozent). Heftig umstritten ist jedoch, ob die erhöhten Fehlbildungsraten der In-vitro-Kultur oder anderen Faktoren anzulasten sind, angefangen vom Alter der Paare über ihre genetischen Vorbelastungen bis hin zu Belastungen bei der Ei- und Samengewinnung.
Neben der großen Fülle potenzieller Einflussfaktoren erschweren auch prinzipielle Mängel der Untersuchungen eine zuverlässige Abschätzung der Risiken. Die üblichen Beobachtungen von einigen hundert oder tausend Babys direkt nach der Geburt erfassen viel zu wenige Kinder in einem viel zu kurzen Zeitraum, um Tausende seltener oder spät auftretender Erbkrankheiten, die jeweils nur ein Gen betreffen, überhaupt nachzuweisen. Hinzu kommen zahllose, noch weitgehend unbeschriebene Krankheitsbilder, die von mehreren Genen abhängen und erst spät auftreten, etwa Störungen der Fruchtbarkeit, der geistigen Entwicklung oder des Verhaltens.
Derzeit ist also sehr wahrscheinlich nur ein winziger Ausschnitt der Realität bekannt. Deshalb fordern angesehene Epidemiologen wie der Amerikaner Roger Gosden eine große internationale Studie, die 100000 Geburten umfasst, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen. In Deutschland allein dürfte es keine Klärung der Fragen geben, welche Imprinting-Defekte IVF und ICSI verursachen. Denn für eine umfassende Studie fehlen hierzulande Personal und Geld, teilweise auch schlicht die Voraussetzungen. So wird in den einschlägigen Tumor- und Krankenregistern nicht die Art der Zeugung der Patienten erfasst. Kinderärzte fragen auch nicht routinemäßig danach. Eine Verknüpfung vorhandener Informationen verbietet in Deutschland zudem das Datenschutzgesetz.
Angesichts der vielen Ungewissheiten schließt Michael Ludwig größere Überraschungen nicht aus. Doch wie vermittelt er als Arzt dieses Problem seinen Patienten? Er könne nur sorgfältig aufklären über bekannte und vermutete Risiken der assistierten Reproduktion. Dazu gehörten auch genetische und durch die Kultur bedingte Imprinting-Defekte.
Vielen Eltern von in vitro gezeugten Kindern ist das große Spektrum potenzieller Risiken allerdings gar nicht bewusst. Deshalb bringen sie spätere seltene Erkrankungen meist auch nicht in Verbindung mit der Zeugungsart. Doch selbst bei Kenntnis des Risikos ist der Babywunsch oft so überwältigend stark, dass er alle Bedenken hinwegfegt (siehe nebenstehenden Bericht). Und wenn die Geburt schließlich erfolgreich verlaufen ist, wollen die wenigsten noch an die assistierte Zeugung erinnert werden. Mögliche Spätschäden werden dann eben als Schicksalsschläge verbucht.
Quelle: DIE ZEIT, 25/2004
Lesen Sie weitere interessante Artikel auf unserer News-Seite