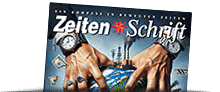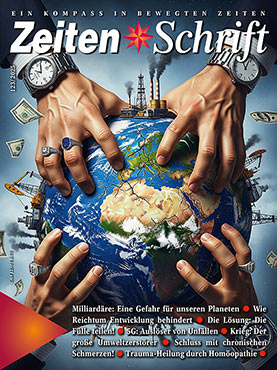Sie sind im News-Archiv der ZeitenSchrift gelandet.
Aktuelle Beiträge finden Sie im Bereich Aktuell.
Wer weniger fernsieht, wird schlauer!
Wenn Medien über Jugendliche berichten, dann häufig in Zusammenhang mit Hyperaktivität, schwachen schulischen Leistungen oder zunehmender Gewaltbereitschaft wie vor kurzem an einer Berliner Hauptschule. Wo aber liegen die Ursachen für ein solches Verhalten? Der Klett-hemendienst sprach mit dem Hirnforscher Professor Manfred Spitzer (47) Er ist ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Uniklinik Ulm und selbst Vater von fünf Kindern.
Herr Professor Spitzer, wo liegen Ihrer Meinung nach die Ursachen für Probleme wie ADS, schwache Schulleistungen oder zunehmende Gewaltbereitschaft? Die Medien sind sicher nicht für alles verantwortlich, aber sind Teil des Problems. Kinder und Jugendliche verbringen – vom Schlafen einmal abgesehen – mit keiner anderen Tätigkeit so viel Zeit: durchschnittlich fünfeinhalb Stunden täglich Bildschirmmedienkonsum, davon dreieinhalb Stunden vor dem Fernseher und zwei Stunden vor dem PC. Auf die Sieben-Tage-Woche umgerechnet ist das mehr Zeit, als Kinder in der Schule verbringen, die nur mit etwa vier Stunden zu Buche schlägt. Damit ist der Konsum von Bildschirmmedien nach dem Schlafen die häufigste Tätigkeit von Jugendlichen. Gleichzeitig wissen wir, dass Fernsehen dick macht, Aufmerksamkeitsstörungen bewirkt, zu Lese- Rechtschreib-Störungen führt und langfristig intellektuelle Minderleistungen verursacht. Das heißt, die Medien erziehen die Kinder mit und prägen sie? Ja natürlich, denn in den Medien werden ja nicht nur positive Werte vorgelebt, sondern auch viel Gewalt gezeigt. Gewaltfreie Konfliktlösungen werden in vier Prozent der Fälle dargestellt. In etwa 50 Prozent der Fälle verursacht die dargestellte Gewalt keine Schmerzen und in über 70 Prozent der Fälle kommt der Gewalttäter ungestraft davon. Weil ein Kind immer lernt (nicht nur, wenn es in der Schule ist), nimmt es auch diese Erfahrungen auf: Gewalt ist fast immer mit im Spiel, tut nicht weh, es gibt keine Alternative zu Gewalt und man kommt davon. Solche Erfahrungen bleiben langfristig in Form von Gedächtnisspuren im Gehirn hängen. Auf diese Weise wird Gewaltbereitschaft antrainiert. In Ihrem Buch „Vorsicht Bildschirm“ prangern Sie die Überflutung mit Bildern als eine Art Umweltverschmutzung an, die junge Menschen schädigt. Sie warnen vor handfesten Folgen für die geistige und körperliche Entwicklung. Ist wirklich das Fernsehen schuld? Es ist bekannt, dass zu viel Fernsehen dick macht. Neben dem statistischen Zusammenhang kennen wir auch den Mechanismus: Wer fernsieht, bewegt sich weniger, isst weniger zu den Mahlzeiten und dafür mehr zwischendurch. Was die Ernährungslehre und die Sportpsychologie für den Zusammenhang von Fernsehen und Dicksein ist, ist die Gehirnforschung für den Zusammenhang von Fernsehen und allen anderen geistig-seelischen Störungen. Wie verändert Fernsehen die Erfahrungswelt und Gehirnstruktur von Kindern? Wenn man eine junge Ratte in einen Käfig sperrt, kommt es zu Störungen der Gehirnentwicklung. Man könnte meinen, dass der Bildschirm für ein Baby eine anregende Umgebung darstellt. Dies ist jedoch nicht der Fall: Ein Baby lernt ganzheitlich, das heißt mit allen Sinnen gleichzeitig. Es muss beispielsweise lernen, ob ein Schatten nur ein Schatten ist oder eine Kante. Und das weiß es erst, wenn es sich gestoßen hat. Durch Fernsehen können Babys solche Erfahrungen aber nicht machen. Bild und Ton kommen aus verschiedenen Richtungen, Fernsehbilder haben keine Tiefe, sie schmecken und riechen nicht, man kann sie nicht greifen. Einem Baby fehlen also mehr als die Hälfte der Informationen zum Lernen, was Objekte sind. Es kann sich die „Welt“ gerade nicht am Bildschirm erschließen. Daher könnte man sagen, dass es kein großer Unterschied ist, ein Baby vor den Fernseher zu setzen oder in den Keller zu sperren. Seit der Jahreswende können rund eine Million Haushalte im baden-württembergischen Kabelnetz „Baby TV“ empfangen, einen internationalen Sender, der speziell Säuglinge und Kleinkinder anspricht – angeblich mit pädagogisch wertvollen Inhalten. Wie beurteilen Sie solche Angebote? Kleine Kinder sollen überhaupt nicht fernsehen, weil es ihnen nur schaden kann. Wir wissen, dass Fernsehkonsum zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr zu Aufmerksamkeitsstörungen in der ersten Klasse führt. Im Alter von fünf Jahren führt Fernsehen zu Lese- Rechtschreib- Schwächen im ersten bis dritten Schuljahr. Und es ist nachgewiesen, dass der Fernsehkonsum mit fünf Jahren die Wahrscheinlichkeit, einen Hochschulabschluss zu erwerben, deutlich negativ beeinflusst. Kritiker halten Ihnen vor, dass nicht das Fernsehen die Ursache für fehlende Schulabschlüsse ist, sondern mindere Intelligenz oder die soziale Herkunft. In professionellen Studien wurden die Intelligenz der Kinder oder die soziale Schicht der Eltern erfasst – diese Effekte können wir also herausrechnen. Das heißt, der Zusammenhang bleibt und die Auswirkungen sind übrigens sehr deutlich: Wenn wir nichts tun, ist das, was wir heute bei den Jugendlichen sehen, erst der Anfang. Dann können wir in 20 Jahren die T-Shirts für China nähen. Sehen viele Eltern das Problem nicht, weil sie als Kinder auch Filme gesehen haben? Die Elterngeneration hat eine ganz andere Fernseh- Sozialisation als ihre Kinder: Früher gab es weniger Programme und deutlich weniger Gewalt – ungefähr 50 Prozent Gewaltanteil gegenüber heute 80 Prozent. Und zudem kennen wir heute den eindeutigen Zusammenhang: Kinder, die weniger fernsehen, wiegen weniger und sie neigen weniger zu Gewalt auf dem Schulhof. Es gibt aber doch auch viele gut gemeinte Bemühungen, Kinder zu einem bewussten Umgang mit den Medien zu erziehen und zu Nutznießern des Informationsangebotes zu machen. Medienkompetenz ist ein anerkanntes Erziehungsziel! Das Schlagwort Medienkompetenz zielt ins Leere. Kinder haben dafür noch nicht die „neuronale Hardware“. Ich kann nicht mit einem Dreijährigen über seinen Süßigkeitenkonsum diskutieren und ebenso wenig mit einem 14-Jährigen über seinen Medienkonsum. Ein Dreijähriger hat weniger empfindliche Rezeptoren für Süßes und ist von der Evolution her darauf programmiert, Energievorräte anzulegen. Ein 14-Jähriger ist darauf programmiert, hinzuschauen, wenn zwei sich balgen oder lieben. Daneben bemüht sich neuerdings der Verein „Media Smart“, Kindern und Jugendlichen den Unterschied von Programm und Werbung zu verdeutlichen. Initiiert hat ihn Super-RTL-Chef Claude Schmit ... Das ist einfach lächerlich! Das ist in etwa so, als würde die Zigarettenindustrie Kindern das Rauchen verbieten und sie gleichzeitig hintenherum mit Drogen versorgen. Wie sollen Kinder denn mit Medien umgehen? Was können Eltern und Lehrer tun? In Deutschland sitzen täglich 800 000 Kinder im Kindergartenalter noch abends um 22 Uhr vor dem Fernseher, um 23 Uhr sind es noch 200 000 und um Mitternacht noch 50 000. Das sollte uns zu denken geben. Aber: Studien haben gezeigt, dass Appelle nichts nützen. Die einzige Chance ist, den Medienkonsum zu reduzieren. Fernseher gehören nicht ins Kinderzimmer! Kinder brauchen Computer erst ab 16! Vorher ist ein Computer für die akademische Entwicklung schädlich. Denn das Wissen, das jemand hat, ist der Filter, den wir brauchen, um zum Beispiel das Internet sinnvoll zu nutzen (und dieses Wissen kommt aus der Schule und aus Büchern, aber nicht aus dem Internet). Ohne Vorwissen liefert das Internet nur Schrott. Dennoch glauben viele Eltern, dass Fernsehen zur Entwicklung einer intelligenten Kinderpersönlichkeit dazugehört. Das trifft nicht zu! Das Argument, dass Nicht-Seher zu Außenseitern werden, ist schlicht falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Wer viel fernsieht, wird Außenseiter, wer weniger fernsieht, wird schlauer. Wenn Eltern ein Problem sehen, sollten sie darüber nachdenken, ob es nicht besser wäre, den Fernseher abzuschaffen. Kinder müssen überhaupt nicht fernsehen. Man kann Kindern kaum einen größeren Gefallen für ihre weitere Entwicklung tun! Das Gespräch führte Mechthild vom BüchelBuchtipps: Vorsicht Bildschirm! von Manfred Spitzer
In diesem Buch werden die bekannten Daten und Fakten zu den Auswirkungen von Bildschirm-Medien auf Körper und Geist zusammenfassend und erstmals vor dem Hintergrund neuester Ergebnisse aus der Gehirnforschung diskutiert. Das Gefahrenpotential von Fernsehen, Video- und Computerspielen, Gameboy und Internetgebrauch wird deutlich gemacht. Medizin und vor allem Gehirnforschung zeigen nicht nur klar und deutlich die negativen Auswirkungen, sondern weisen auch Wege zum konkreten HandelnQuelle: http://www.kidnet.de/detail.php?id=2457&m=0&grid=13
Lesen Sie weitere interessante Artikel auf unserer News-Seite