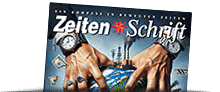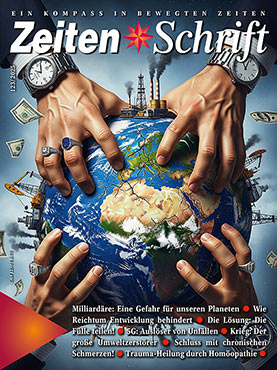Zehn Jahre sind vergangen seit der Zulassung des ersten genmanipulierten Lebensmittels, der so genannten Antimatschtomate. Seither hat die Agro-Gentechnik einen anscheinend beispielhaften Triumphzug hinter sich. Die weltweite Anbaufläche gentechnisch manipulierter Pflanzen ist mittlerweile auf die doppelte Größe Deutschlands, knapp 70 Millionen Hektar, angewachsen.
Von Andreas Bauer

Dass Gentechnik das beste Instrument zur Bekämpfung des Welthungers sei und die Erträge mit ihrer Hilfe gesteigert werden könnten, wird aufgrund jahrelanger Propaganda der Gentechnikindustrie nur von wenigen hinterfragt. Kein Wunder, wird diese doch von Marketingspezialisten wie der PR-Agentur Burson-Marsteller unterstützt, einer Firma, die unter anderem für das Pentagon Methoden zur psychologischen Kriegsführung entwickelt und Großkonzernen bei der Vertuschung von Umweltkatastrophen hilfreich zur Seite steht (z.B. dem Exxon-Konzern bei der Ölkatastrophe der Exxon Valdez oder Union Carbide beim Giftgasunfall in Bhopal).1 Wenn man jedoch die Thesen, mit denen Konzerne und Politik seit Jahren um gesellschaftliche Akzeptanz buhlen, auf ihre wissenschaftliche Haltbarkeit prüft, bleibt vom schönen Schein nicht viel übrig.
Dokumentierte Resistenzen in den USA und Kanada
Beifußblättriges Traubenkraut, Ambrosia artemisiifolia (engl. Ragweed)
Tannenwedel, Hippuris vulgaris (Mare´s tail, Horseweed)
Commelina benghalensis (Tropical spiderwort)
Amaranthus tuberculatus (Water hemp )
Steifes Weidelgras, Lolium rigidum (Rigid rye Grass)
Chinesischer Hanf, Samtpappel, Abutilon theophrasti (Velvetleaf) und
Welsches Weidelgras, Lolium multiflorum, (Italian ryegrass)
1. Gentechnik auf dem Acker reduziert den Einsatz von Pestiziden
Entgegen allen Versprechungen führt der Anbau von Gen-Pflanzen nicht zu einer Verminderung des Einsatzes umweltschädlicher Pestizide. Rückgänge sind, wenn überhaupt, nur für die Dauer weniger Jahre zu belegen. Nach dieser Zeit steigt die Menge der eingesetzten Pestizide deutlich an. In den USA werden - nach lediglich sechs Jahren Anbau - auf den Gen-Feldern bereits 13 Prozent mehr Pestizide versprüht als auf konventionellen Äckern, mit stark zunehmender Tendenz.2 Auch die Verwendung des insektenresistenten Bt-Mais (mit einem Bakteriengen, das ein Insektengift produziert), führt nicht zu einem geringeren Einsatz umweltschädlicher Pestizide3. Hauptgrund für diesen Anstieg ist die zunehmende Resistenz der Ackerkräuter gegen die eingesetzten Herbizide. Zu einem hartnäckigen Unkraut ist jedoch vor allem herbizidresistenter Gen-Raps geworden: Gen-Rapssorten, die jeweils gegen verschiedene Herbizide resistent waren, haben sich untereinander gekreuzt und sind nun gegen alle eingesetzten Totalherbizide resistent ("gene stacking"). Raps-Samen können darüber hinaus mehr als 15 Jahre keimfähig im Boden überdauern. Da viele der winzigen Samen bei der Ernte auf dem Feld bleiben, dauert es bis zu zehn Jahren, bis gentechnikfreier Raps auf einem Acker angebaut werden könnte, auf dem einmal Gen-Raps gewachsen ist. Um der Plage Herr zu werden, werden in Nordamerika deshalb zunehmend hochgiftige, alte Pestizide oder Pestizid-Cocktails eingesetzt. Argentinien hat dasselbe Problem mit Gen-Soja. Bei etlichen Sorten führt die Genmanipulation zusätzlich zu einer erhöhten Anfälligkeit der Pflanzen gegenüber anderen Schädlingen oder Krankheiten.4 Diese müssen dann wiederum mit Gift bekämpft werden. Und selbst in Fällen, in denen kurzzeitige Rückgänge der Pestizidmenge festgestellt werden, handelt es sich um Strohfeuer. Laut Aussagen chinesischer Forscher wird der Schädling, dem mit Gen-Baumwolle der Garaus gemacht werden soll, in wenigen Jahren resistent gegen das Gift der Gen-Pflanzen sein.5
2. Der Anbau transgener Pflanzen schont die Umwelt
Dass der zunehmende Einsatz von Pestiziden nicht zu einer Entlastung der Umwelt beiträgt, liegt auf der Hand. Totalherbizide haben zudem ein sehr breites Wirkungsspektrum: Sie vernichten alles pflanzliche Leben, nur die Gen-Pflanzen überleben. Doch viele Ackerkräuter bieten auch Nahrung für Insekten, diese wiederum für Vögel und andere Säugetiere. Das lange Jahre als umweltschonend angepriesene Totalherbizid Roundup der Firma Monsanto ist zudem krebserregend und hoch giftig für Fische und Insekten.6 Und so wurden auch in der bislang größten Langzeitstudie über die Auswirkung von GVO auf Fauna und Flora massive negative Folgen für die biologische Vielfalt festgestellt:7 o 24 Prozent weniger Schmetterlinge in herbizidresistentem Raps, o bei Gen-Raps 44 Prozent, bei Gen-Zuckerrüben 34 Prozent weniger Blütenpflanzen. Innerhalb von zwanzig Jahren, so eine Modellrechnung, würde der Anbau von Gen-Zuckerrüben zum Aussterben der Feldlerche führen: Durch die Totalherbizide würde ihre Hauptfutterpflanze verschwinden.8
3. Transgene Pflanzen erzielen höhere Erträge
Der Ertrag von GVO-Pflanzen liegt im allgemeinen nicht über dem konventionell gezüchteter Sorten. Es gibt heute keine einzige transgene Pflanzensorte, die auf hohe Erträge hin verändert wurde. Genmanipulierte Sojapflanzen erzielen im Gegenteil einen Minderertrag von sechs bis zehn Prozent9, bei transgenen Zuckerrüben und Raps liegen die Erträge fünf bis acht Prozent unter dem konventioneller Vergleichssorten10. Auch die Erträge von Gen-Mais sind im Durchschnitt nicht höher als bei konventionellen Sorten. In Indien brachen die Erträge der transgenen Bt-Baumwolle teilweise um 75 Prozent ein, auch die Qualität der geernteten Fasern erwies sich als minderwertig. Der Grund für dieses Phänomen ist vermutlich, dass die Genmanipulation den Gesamtstoffwechsel von Pflanzen auf nicht steuerbare Weise verändert.
4. Gentechnik bedeutet höhere Gewinne für die Bauern
Auch die Behauptung, der Einsatz von GVO-Pflanzen würde den Bauern zu höheren Gewinnen verhelfen, gehört ins Reich der Legenden11. Kurzfristigen Einsparungen bei Betriebsmitteln stehen hohe Ausgaben für das patentgeschützte Saatgut gegenüber. In Indien z.B. ist genmanipuliertes Baumwoll-Saatgut um 400 Prozent teurer als konventionelles. Auch Studien in Gebieten, die einen höheren Ertrag der GV-Pflanzen aufweisen, kommen daher im Endeffekt auf ein reduziertes Einkommen der Bauern. Charles Benbrook, ehemaliger Präsident des Landwirtschaftsausschusses der US-Akademie der Wissenschaften errechnete für die Jahre 1996 bis 2001 einen Gesamtverlust von 100 Millionen US-Dollar durch den Anbau von Bt-Mais, trotz leicht gestiegener Erträge12. Zudem droht nach Berechnungen des Gentechnik-Konzerns Syngenta beim Auftreten resistenter Ackerkräuter pro Hektar Ackerland ein Wertverfall um fast 20 Prozent.13 Einer Studie der britischen Soil Association zufolge summieren sich die durch GVO verursachten Kosten für die US-Landwirtschaft durch Rückrufaktionen, Verkaufsausfälle, Kontaminationen, zusätzliche Subventionen etc. in den letzten Jahren auf inzwischen zwölf Milliarden Euro.14 Allein die Verschmutzung der Nahrungskette mit dem nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen StarLink-Mais verursachte bis heute Kosten von über einer Milliarde US-Dollar. Und laut Aussage eines Managers des verantwortlichen Konzerns,wird er nie wieder ganz aus der Nahrungskette zu entfernen sein.
5. Genmanipulierte Nahrungsmittel sind getestet und gesundheitlich unbedenklich
Fast alle transgenen Pflanzen werden zuerst in den USA zugelassen. Dort erfolgen die Sicherheitsprüfungen jedoch lediglich auf der Grundlage "freiwilliger Konsultationen" mit den Gentechnik-Konzernen. Diese entscheiden selbst, welche Daten sie den Behörden zukommen lassen. Im Endeffekt lassen sie sich ihre Produkte selber zu, laut einer Studie sind die Verfahren nicht den Stempel wert, mit dem die Bescheide erteilt werden15. Dieser skandalöse Zustand wird durch die Infiltrierung der Zulassungsbehörden durch Mitarbeiter der Gen-Industrie noch verschärft.16 Bestes Beispiel: US-Landwirtschaftsministerin Ann Veneman. Vor ihrer Ernennung war sie u.a. im Vorstand des Gentechnik-Konzerns Calgene, der die erste Gen-Tomate auf den Markt brachte. Die Firma wurde wenig später von Monsanto geschluckt. Auf Basis der US-Daten erfolgen auch die Zulassungen in der EU. Und leider arbeiten auch in der EFSA, der für die EU verantwortlichen Behörde, viele Gentechnik-Propagandisten. Unabhängige Wissenschaftler weisen in Tierversuchen immer wieder Missbildungen von Nieren, Leber oder Blutbild durch Gen-Pflanzen nach. Doch die kritischen Forscher sind in der Minderheit: Rund 90 Prozent der Genforscher arbeiten im Dienste der Industrie. Da wundert es nicht, dass in den USA trotz einer vierzigprozentigen Zunahme ernährungsbedingter Erkrankungen seit der Einführung von Genpflanzen jeglicher Bezug geleugnet wird. Und das, obwohl auch die molekularbiologischen Grundlagen der Gentechnik mittlerweile so fragwürdig sind, dass die immer wieder gehörten Argumente von Sicherheit und Risikolosigkeit genmanipulierter Pflanzen und Lebensmittel jeglicher Grundlage entbehren.
6. Wir brauchen die Gentechnik zur Bekämpfung des Welthungers
Es ist eine Binsenweisheit, dass weltweit mehr als genug Nahrungsmittel erzeugt werden, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Warum hungern dennoch rund 850 Millionen Menschen? Gerade in armen Ländern werden 20 bis 30 Prozent der Erntemenge durch Lagerschäden vernichtet. Schlechte Infrastruktur, Verschuldung, die Marginalisierung von Kleinbauern und die exportorientierte Landwirtschaft in den meisten Ländern des Südens, erzwungen durch WTO, Internationalen Währungsfonds und Weltbank, sind die größten Feinde der Ernährungssicherung in den Entwicklungsländern. In Indien verrotteten z.B. im Jahre 2002 viele Millionen Tonnen Reis, die für den Export produziert worden waren. Zur gleichen Zeit hungerten 50 Millionen Menschen im Land. Gentechnik geht an den Bedürfnissen der Entwicklungsländer vorbei. Eine Studie17 über die Probleme philippinischer Reisbauern ergab zum Beispiel folgende Hierarchie: 1. Marktbedingungen, 2. Bewässerungsmöglichkeiten, 3. Trocknung/Lagerung, 4. Verschuldung durch Dünger- und Pestizidkauf, 5. Fehlende öffentliche Unterstützung, 6. Stürme, 7. Schlechte Transportwege, 8. Ungerechte Landverteilung, 9. Trockenheit, 10. Schäden durch Pestizideinsatz, 11. Geringe Bodenfruchtbarkeit, 12. Wenig Forschung und Entwicklung, 13. Schädlingsbefall, 14. Ertragsschwankungen, 15. Überflutung, 16. Bodenerosion, 17. Pflanzenkrankheiten, 18. Geringe Sortenauswahl, 19. Geringe Essqualität. Deutlich wird zweierlei: Die Probleme, für die die Gentechnik Lösungen anbietet (Schädlinge, Pflanzenkrankheiten) rangieren in der Rangfolge auf den hinteren Plätzen (13,17). Dagegen sind die zentralen Probleme, neben natürlichen Gegebenheiten, die zutiefst ungerechten Bedingungen des Weltmarktes (1), Verschuldung durch den Kauf von Agrochemikalien, die wiederum zu Gesundheits- und Bodenschäden führen, oder die ungerechte Landverteilung. Durch Gentechnik-Monokulturen werden jedoch die politischen Probleme ebenso verschärft wie die wirtschaftlichen (Verschuldung, 4) und ökologische Schäden (Pestizide, 10). Darüber hinaus ist nur ein verschwindend geringer Teil der angebauten GVO überhaupt für den menschlichen Verzehr gedacht. Gen-Soja, -Mais und -Raps landen zu 80 Prozent in Mastfabriken und Ställen der Industrieländer. Die heutige Agro-Gentechnik ist eine Futtermitteltechnologie. Groteskerweise trommeln gerade diejenigen Firmen für die Gentechnik als Lösung des Welthungers, die durch die aktive und aggressive Einführung der Industrie-Landwirtschaft in der Dritten Welt, von Hochertragssorten, Pestiziden und Kunstdünger zur Ertragssteigerung, wesentlich zu Hunger, zerstörten Böden, kaputten Ökosystemen und der Konzentration von Land und Macht in den Händen weniger beigetragen haben. Die einzige Form von Hunger, den die Konzerne, die zu fast 100 Prozent den Markt für genmanipulierte Pflanzen beherrschen, stillen, ist eben nicht "der Hunger in der Dritten Welt, sondern der Hunger der Aktionäre" (EU-Kommissarin Margot Walström).
Beispiel Goldener Reis
Ein Narzissen-Gen soll den Reis Vitamin A produzieren lassen. Immer wieder wird von Gentechnik-Befürwortern als Beleg für das Potenzial der Gentechnik zur Beseitigung der Hungerproblematik der "Golden Rice" ins Feld geführt. Doch gerade an diesem Produkt wird die rein mechanistische und verkürzte Sicht der Genforscher ebenso deutlich wie die Steuerung dieses vorgeblich "humanitären" Projektes durch die mächtigen Gentechnikkonzerne. In dieses einzige Gentechnik-Produkt, das ohne Patentgebühren verkauft werden soll (zumindest für Kleinbauern mit weniger als zehntausend US-Dollar Jahreseinkommen), wurden Narzissengene implantiert, die zur Bildung von Beta-Karotin, einer Vorstufe von Vitamin A, im Korn führen. Das Ziel: Vitamin A könnte die Erblindung vieler Menschen in den Reisanbaugebieten der Welt verhindern. Doch die Idee "Golden Rice" ist auf haarsträubende Weise kurz gedacht:
Auch nach über zehn Jahren Forschung ist der Gehalt an Vitamin A so gering, dass ein Erwachsener mehrere Kilo davon essen müsste, um die notwendige Tagesdosis zu erhalten.
Um Vitamin A aufnehmen zu können, braucht der Körper Fettreserven. Unterernährte Menschen, für die dieser Reis angeblich konstruiert wurde, haben von diesem angeblichen "Wunderreis" also überhaupt nichts.
Im "Golden Rice" stecken 70 Patente, über die 32 Patentinhaber verfügen, die in diesem einen Fall auf die Erhebung von Lizenzgebühren verzichten, nicht aber grundsätzlich auf ihre Patente. Im Gegenzug bedeutet dies, dass das Hauptnahrungsmittel eines Großteils der Weltbevölkerung bereits zu einem erschreckenden Ausmaß unter die Kontrolle transnationaler Konzerne geraten ist.
Die Erblindung von Hunderttausenden ist eine direkte Folge der Einführung der westlichen Industrielandwirtschaft (der so genannten "grünen Revolution") und des damit einhergehenden Rückgangs biologischer Vielfalt und traditioneller Ernährung in vielen Entwicklungsländern - und kein Problem einer angeblich "rückständigen" Landwirtschaft in vielen Ländern der Dritten Welt. Traditionelle indische Gemüsearten, früher in jedem Hausgarten vorhanden, besitzen u.a. ein vielfaches der angestrebten Beta-Karotingehalte des "Golden Rice". Ein Löffel Korianderblätter z.B. enthält den Tagesbedarf an Provitamin A.
In Asien gibt es sogar traditionelle Reissorten, die einen vielfach höheren Gehalt an Vitamin A aufweisen, als beim "Golden Rice" angestrebt ist.
Und auch handelsübliche Reissorten enthalten Provitamin A. Der Unterschied ist lediglich, dass sich das Beta-Karotin in der Schale befindet. Geschälter Reis wurde mit der ‚Grünen Revolution' eingeführt und ungeschälter stigmatisiert. Das Ergebnis: Vitamin A-Mangel.
Im Endeffekt werden beim goldenen Reis 100 Millionen US-Dollar dafür ausgegeben, Beta-Karotin von der Schale ins Korn zu bekommen. Das ist das ganze Geheimnis um die "Wunderwaffe" im Kampf gegen Mangelernährung in der Dritten Welt. Mit Millionenaufwand erfindet die Gentechnik-Industrie das Rad neu, um der Weltöffentlichkeit vorgebliche humanitäre Ideale glaubhaft zu machen.
Treibende Kraft hinter dem Projekt "Golden Rice" ist der Agro-Konzern Syngenta. Erst kürzlich wurden die Rechte von Forschern, denen von Syngenta freier Zugang zu den patentierten Verfahren des Konzerns garantiert worden war, drastisch beschnitten. Die ersten Freisetzungsversuche mit dem "Golden Rice" finden nicht etwa in den Mangelgebieten der Dritten Welt statt, sondern in den USA, verwendet wird die für den US-Markt wichtigste Reissorte. Das Projekt "Golden Rice", inzwischen von Gerard Barry koordiniert, vormals Forschungsdirektor bei Monsanto18 wird von den zwei größten Gentechnik-Konzernen der Welt kontrolliert. Zehn Jahre nach der Einführung transgener Pflanzen in der Landwirtschaft kann man festhalten: Keine der Versprechungen der Gentechnikindustrie, angefangen bei höheren Erträgen bis zu einer Ökologisierung der landwirtschaftlichen Produktion hat sich bewahrheitet. Im Gegenteil sind gerade die ökologischen Konsequenzen des GVO-Einsatzes in der Landwirtschaft katastrophal. In Argentinien werden die letzten naturbelassenen Wälder den Gen-Soja-Monokulturen geopfert. Unersetzliche Naturschätze werden einer kurzgedachten Profitmaximierung geopfert. Doch dieses Denken wird in einer ökonomischen und ökologischen Katastrophe enden: Durch den unmäßigen Einsatz von Totalherbiziden werden die empfindlichen Böden so stark geschädigt, dass sie nach Angaben eines argentinischen Agrarforschungsinstitutes innerhalb weniger Jahre unvermeidlich ihre Ertragsfähigkeit einbüßen: In der Folge wird es zu dramatischen Ernteeinbrüchen kommen.
Lesen Sie weitere interessante Artikel auf unserer
News-Seite Dass Gentechnik das beste Instrument zur Bekämpfung des Welthungers sei und die Erträge mit ihrer Hilfe gesteigert werden könnten, wird aufgrund jahrelanger Propaganda der Gentechnikindustrie nur von wenigen hinterfragt. Kein Wunder, wird diese doch von Marketingspezialisten wie der PR-Agentur Burson-Marsteller unterstützt, einer Firma, die unter anderem für das Pentagon Methoden zur psychologischen Kriegsführung entwickelt und Großkonzernen bei der Vertuschung von Umweltkatastrophen hilfreich zur Seite steht (z.B. dem Exxon-Konzern bei der Ölkatastrophe der Exxon Valdez oder Union Carbide beim Giftgasunfall in Bhopal).1 Wenn man jedoch die Thesen, mit denen Konzerne und Politik seit Jahren um gesellschaftliche Akzeptanz buhlen, auf ihre wissenschaftliche Haltbarkeit prüft, bleibt vom schönen Schein nicht viel übrig.
Dass Gentechnik das beste Instrument zur Bekämpfung des Welthungers sei und die Erträge mit ihrer Hilfe gesteigert werden könnten, wird aufgrund jahrelanger Propaganda der Gentechnikindustrie nur von wenigen hinterfragt. Kein Wunder, wird diese doch von Marketingspezialisten wie der PR-Agentur Burson-Marsteller unterstützt, einer Firma, die unter anderem für das Pentagon Methoden zur psychologischen Kriegsführung entwickelt und Großkonzernen bei der Vertuschung von Umweltkatastrophen hilfreich zur Seite steht (z.B. dem Exxon-Konzern bei der Ölkatastrophe der Exxon Valdez oder Union Carbide beim Giftgasunfall in Bhopal).1 Wenn man jedoch die Thesen, mit denen Konzerne und Politik seit Jahren um gesellschaftliche Akzeptanz buhlen, auf ihre wissenschaftliche Haltbarkeit prüft, bleibt vom schönen Schein nicht viel übrig.