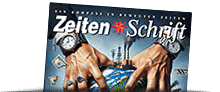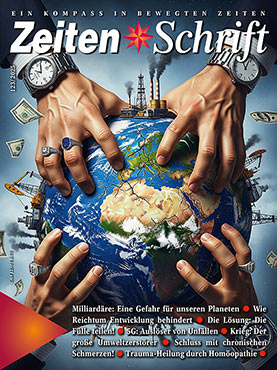Sie sind im News-Archiv der ZeitenSchrift gelandet.
Aktuelle Beiträge finden Sie im Bereich Aktuell.
Google - Der Feind im eigenen Computer
 OÖN: Sie übertitelten Ihren Vortrag mit „Google – Freund oder Feind? Tendieren Sie zu Letzterem?
OÖN: Sie übertitelten Ihren Vortrag mit „Google – Freund oder Feind? Tendieren Sie zu Letzterem?
Maurer: Würde man die Menschen fragen, was sie ohne Google machen würden, wäre die Antwort von drei Viertel der Leute, sie wären verzweifelt. Sicherlich ist die Suchmaschine Google etwas sehr nützliches und einigermaßen objektiv und funktioniert auch gut.
Andererseits ist jede Firma, die sehr intensiv versucht möglichst viel aus allen möglichen Internetquellen abzulesen, gefährlich. Google ist besonders gefährlich, weil sie eine derartig beherrschende Machtstellung besitzt. Würde Google nur die Suchmaschine betreiben und nur dort ein Fast-Monopol haben, wäre das zwar nicht angenehm, aber noch zu verdauen. Was nicht mehr geht, ist, dass diese Firma weltweit mehr als 80 Firmen betreibt, von denen man oft nicht einmal weiß, dass sie Google gehören.
OÖN: Weiß man, was Google in diesen Firmen treibt?
Maurer: Fast alle Daten, die bei Google - etwa über Google-Mail oder Google-Docs - einlangen, werden durch automatische, recht intelligente Programme gescannt. Wenn dabei irgendwelche interessanten Worte vorkommen, wird das einem Analystenstab vorgelegt. Google ist ja sehr geschickt, ich bewundere sie. Sie bieten zum Beispiel Google Analytics an, das beste Statistik-Werkzeug, das man sich auf seinem Web-Server installieren kann. Im Kleingedruckten behält sich Google allerdings vor, gewisse Daten daraus zu verwenden.
OÖN: Google unterliegt keiner Kontrolle?
Maurer: Richtig. Bei der nächsten Generalversammlung der Google-Aktionäre wird ein Antrag eingebracht, eine Menschenrechtskommission einzusetzen. Der wird von den Google-Gründern, die die Aktienmehrheit haben, abgelehnt werden. Ein weiterer Antrag, wonach Daten aus Diktaturen nicht abgespeichert werden sollen, wird ebenfalls abgelehnt werden. Für Google ist das Geschäft wichtiger geworden als gewisse moralische Bedenken. Googles Werbeslogan „Do no evil“ ist inzwischen ein Witz geworden.
OÖN: Wie hält es Google mit der Moral?
Maurer: Man kann Google-Vertetern Fragen stellen, auf die sie keine Antwort haben. Die typische Frage lautet: Angenommen die Regierung X bietet Google fünf Millionen Dollar für die Dossiers von 100 Personen, die z. B. Oppositionelle sind. Was würde Google tun. Wenn Google öffentlich sagte, sie würden die Daten ihrer Kunden nicht hergeben, riskierten sie eine Klage von Aktionären. Denn als Aktiengesellschaft kann Google ein Angebot über fünf Millionen nicht ablehnen. Sagt Google aber, sie würde die Daten verkaufen, verlieren die Menschen das Vertrauen in die Firma.
OÖN: Was also tun?
Maurer: Man müsste Google zerschlagen. Die Suchmaschine müsste von den anderen Firmen getrennt werden. Auch einzeln wäre das ein gutes Geschäft, es würden weder die Aktionäre leiden noch die Besitzer, aber man hätte eine Schnittstelle, über die keine Daten ausgetauscht werden dürfen. Ein zweiter Schritt wäre, das Monopol von Google zu brechen. Eine Möglichkeit wäre, dass man verteilte Suchmaschinen aufbaut, Spezialsuchmaschinen für Spezialgebiete: eine für Maschinenbau, eine für Tourismus, Medizin oder Biografien berühmter Persönlichkeiten. Und jeder europäische Staat möge drei oder vier davon betreiben. Damit liege ich der EU-Kommission seit zwei Jahren in den Ohren.
OÖN: Offensichtlich mit keinem allzugroßen Erfolg ...
Maurer: Nein, stattdessen beginnt Google selbst, Spezialserver und –dienste zu entwickeln.
OÖN: Was muss passieren, um auf die Gefahr durch Google zu reagieren?
Maurer: Vor zwei Jahren war Google jedem nur ein Freund. Inzwischen gibt es schon eine ganze Reihe von kritischen Berichten in den Medien. Es gibt ein erstes Aufwachen, dass Google so ohne nicht ist. Das muss weiter gehen. Der zweite Ansatz ginge über die Schulen. Aber das Problem ist Lehrern zu wenig klar.
OÖN: In den Schulen und Universitäten geht es vorrangig um Plagiatsbekämpfung, oder?
Maurer: Wenn heute ein Lehrer eine Aufgabe stellt wie „Analysiere die Rolle von Hamlet“, geht jeder vernünftige Schüle auf www.hausaufgaben.de, holt sich einen schönen Aufsatz und kriegt ein „sehr gut“ dafür. Mehrsprachige holen sich den Aufsatz zum Beispiel aus dem Italienischen und über setzen ihn. Ähnliches erleben wir auf den Unis.
OÖN: Wie bekämpft man das?
Maurer: Es gibt Plagiatssuchprogramme, aber eines der großen Probleme der dabei ist, dass die in bezahlte Datenbanken nicht hineinkommen oder kleinteiliges Copy-Paste nicht finden. Schüler, die auf diese Weise Sachen zusammenstopeln, verstehen ihre eigenen Arbeiten oft nicht mehr.
OÖN: War das nicht früher auch so, dass abgeschrieben wurde, aus Büchern halt. Hat sich das Abschreibesystem nicht einfach nur beschleunigt?
Maurer: Es hat sich beschleunigt und verstärkt. Schätzungen sprechen von einer Verdoppelung bis zur Versechsfachung der Plagiatsfälle. Auf der anderen Seite haben wir neue Werkzeuge zum Aufspüren, von denen die allermeisten Lehrer noch nichts gehört haben. Zum Beispiel die Stilometrie. Das sind Programme, die schauen, ob sich in einer Arbeit der Schreibstil ändert.
OÖN: Wie haben sich Studierende in Zeiten der Copy-Paste-Arbeiten verändert? Was lernen sie nicht mehr?
Maurer: Man gewöhnt sich daran, nur noch Häppchen zu lesen, wie es im Blogging üblich ist. Große Zusammenhängende Stücke werden nicht mehr gelesen und verstandenen. Ich behaupte, dass heute viel weniger Studenten Kierkegaard verstehen können, als zu meiner Zeit. Wir hatten damals relativ komplexe Sachen zu lesen gehabt, das wird heute nicht mehr akzeptiert.
OÖN: Googles Forschungschef fordert, das Erziehungssystem müsse sich auf die geänderten Bedingungen einstellen …
Maurer: Dem kann man nichts entgegen halten. Das Erziehungssystem muss sich ändern – nicht wegen Google, sondern wegen anderer Sachen. Das Internet ist mit und ohne Google eine gewisse Gefahr, weil wir immer mehr externalisieren. Wir lagern immer mehr aus dem Kopf aus. Statt uns eine Telefonnummer zu merken, speichern wir sie im Handy. In zehn Jahren wird auf einem Handy zehn Terrabyte Speicher drauf sein. Informationen, die man häufig braucht, hat man lokal und alles andere über schnelle Internet-Verbindungen. Es fragt sich: Werden meine Enkelkinder noch alle Blumen in den Alpen lernen? Dagegen muss man arbeiten. Vielleicht geht das soweit, dass wir eines Tages Fitnessstudios fürs Hirn brauchen. Die Elektronik birgt in sich die Gefahr, dass wir immer enger in Symbiose mit einem Gerät leben. Wenn das einmal ausfällt - gnade uns Gott.
OÖN: Zurück zum Erziehungssystem. Was sollte daran geändert werden?
Maurer: Man sollte zum Beispiel aufhören, Handschrift zu unterrichten. Sechsjährigen eine flüssige Schrift beizubringen ist überflüssig. Wenn Schüler aus der Schule kommen, benutzen sie Tastatur, Maus, Spracheingabe oder vielleicht noch einen Zettel, auf den sie in Großbuchstaben „Ich bin im Kino“ schreiben.
OÖN: Wo bleibt dann die Ausbildung der Feinmotorik?
Maurer: Die Hand-Augen-Koordination und die Feinmotorik, die durch das Schreiben gefördert wird, brauchen wir. Deshalb fordere ich endlich auf, dass wir ein paar kognitive Psychologen forschen lassen, ob nicht vielleicht Jonglieren mit drei Bällen die Feinmotorik noch stärker fördert als Schreiben. Wir müssen acht geben, dass wir nicht Sachen aus der Vergangenheit übernehmen, weil sie immer gemacht worden sind.
Anderes Beispiel: In der Mittelschule haben wir Dreieckskonstruktionen gelernt. Welch fade und unsinnige Geschichte. Ich brauche das nie, fast kein Mensch hat das nach der Schule gebraucht. Man sollte das streichen und er setzen durch eine Stunde Schachspiel. Das logische Denken ist wichtig, man sollte es nicht den Computern überlassen. Aber muss man das mit so etwas Fadem machen wie Dreieckskonstruktionen, kann man das nicht mit Schach, Bridge oder Go auch tun?
OÖN: Die Technik ändert sich derart rasant, dass lebenslanges Lernen immer wichtiger wird …
Maurer: Wir sollten die Matura mit 14 Jahren machen und den Lernstoff entsprechend zusammenkürzen. Warum soll ein Kind geschichtliche oder geografische Daten bis zum Geht-nicht-mehr auswendig lernen, wenn wir das ohnehin externalisieren. Das Kind muss so viel in Geografie lernen, dass es weiß, was Polen ist. Die Studenten wären viel früher fertig und könnten früher arbeiten. Anschließend sollte man einen verpflichtenden, auch bezahlten Unterricht von drei Wochen pro Jahr einführen bis zum 70. Lebensjahr. Da könnte man Sachen unterrichten, die aktuell sind. Was hat es für einen Sinn, wenn wir heute einen Zehnjährigen etwas über Computer beibringen. Wenn der mit 18 Jahren maturiert, hat sich die Computerwelt so dramatisch verändert, dass das, was er gelernt habt, fast für die Katze ist.
OÖN: Zurück zu Google: Welchen Gefahren sehen Sie konkret auf uns zukommen?
Maurer: Die erste Gefahr ist, dass Google Dossiers sammelt über Personen, Istitutionen und Firmen mit dem berechtigten Argument, dass sie ein Profil von einer Person brauchen, um sie gut bedienen zu können. Wenn sich der Herr Maurer ein Hotel aussucht, dann wollen die wissen, ob der Vegetarier oder Nichtraucher ist und ein Hotel mit vegetarischem Nichtraucher-Restaurant will. Die Tatsache, dass man Profile von Personen aufbaut ist sehr wichtig – auch für den Benutzer. Ich bin aber dagegen, dass die Profile bei den Suchmaschinen liegen. Ein Vorschlag wäre, dass Abfragen über Gateways gehen, und man in jedem Land drei oder vier solcher Gateways hat.
OÖN: Was wäre deren Funktion?
Maurer: Das Gateway baut das Profil von mir auf. Es lernt über mich. Wenn ich aber eine Anfrage an Google oder ein Hotelreservierungssystem stelle, wird die Anfrage mit Profil aber ohne Namen weitergeleitet. Das Schöne daran wäre, dass diese Gateways dem österreichischen Datenschutz unterliegen würden. Das wäre ein wesentlicher Schritt vorwärts, der niemandem weh tun würde.
OÖN: Die Datenschatzkammer von Google wäre weniger wert …
Maurer: Ich nenne Google immer die größte Detektivagentur, die wir je gehabt haben. Dazu kommt, dass uns Google durch das Ranking von Anzeigen und Suchenergebnissen beeinflusst. Google bestreitet das zwar, aber wenn ich als Fabrikant Digitalkameras erzeugen würde, würde ich sofort mit Google verhandeln, wie viel ich zahlen muss, damit meine Firma an erster Stelle auftaucht. Ich bin sicher, dass das Firmen tun, nur sie dürfen es nicht zugeben. Mir tun die Chefs von Google geradezu leid. Sie sitzen auf einer Schatztruhe, sie können die aber nicht richtig nutzen. Würden die das tun, würden die Kunden das Vertrauen in das Angebot verlieren. Google weiß mehr über die Zukunft als das Orakel von Delphi je gewusst hat. Die wissen zu 99 Prozent, wo in Amerika die Grundstückspreise steigen oder fallen, wie sich der Kupferpreis einwickelt usw. Wenn ich so etwas weiß, kaufe ich sofort Grundstücke oder Aktien, ich spekuliere.
Ich bin sicher, dass das Google tut, aber unheimlich vorsichtig dabei sein muss. Denn wenn sie es zu offensichtlich machen, ruinieren sie den Markt. In der Spieltheorie heißt es: Sobald einer der Spieler zu viele Informationen hat, ist das Spiel zu Ende. Google hat zuviel Informationen, verwendet sie aber nicht – aus Egoismus. Würde Google ihre Informationen ein setzen, brächen die Börsen zusammen. Das will Google nicht, weil der Wert von Google in deren Aktien liegt. Ich beneide die Führung von Google nicht ob der Gratwanderung zwischen dem, was sie könnten und dem, was sie vernünftigerweise machen, um ihren guten Ruf nicht zu gefährden.
OÖN: Sie hatten ihren Erstkontakt mit Computern 1962. Wie haben denn Computer die Menschen in der westlichen Welt seither verändert?
Maurer: Ich glaube, dass Fernsehen die Menschen mehr verändert hat als die Computer. Die wirkliche Auswirkung liegt in der Kommunikation. Es gäbe keine Globalisierung, würde es globale Computer- und Kommunikationsnetzwerke nicht geben. Das macht uns verletzlich. Wir werden demnächst nur noch über IP telefonieren. Wenn einmal das IP-Netzwerk zusammenbricht, werden wir schön dastehen.
OÖN: Wie weit ist der Big Brother noch von uns entfernt?
Maurer: Wir sitzen sehr knapp beim Big Brother. Die USA sind die herrschende Militärmacht der Welt. Durch Google werden sie die herrschende Informationsmacht. Und der US-Staat unterstützt Google. Ich verstehe nicht, dass Europa da nichts tut. Google hat so viel Macht wie noch nie jemand in unserer Branche.
OÖN: Heißt es nicht schon hinter vorgehaltener Hand, der Maurer sei schon ein bisschen paranoid?
Maurer: Ich habe schon so viel gegen Google geschrieben, dass ich langsam als Don Quichote gelte. Ich bin in der EU schon ein Grenzfall hinsichtlich Querulanz. Deshalb werde ich mich zurücknehmen. Ich habe das gemacht, was ich als Professor tun musste.
Quelle: OÖ Nachrichten