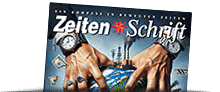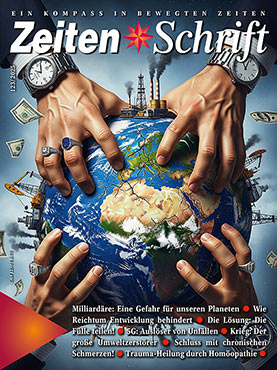Die "Genfer Initiative", die von israelischen und palästinensischen Persönlichkeiten ausgearbeitete detaillierte Friedensinitiative, hat offensichtlich die israelische Regierung und ihre Politik in Bedrängnis gebracht, da diese letzte Woche den Schweizer Botschafter in Tel Aviv ins Aussenministerium zitiert hat.

rw./yr. Diese steht aber auch sonst unter grossem Druck: Die verfehlte Politik der israelischen Regierung wird in letzter Zeit in Israel unüberhörbar kritisiert, und es gibt Demonstrationen und Streiks wegen der desolaten finanziellen Situation einer grossen Zahl israelischer Bürger. So leben über 300'000 israelische Familien mit rund 600'000 Kindern bereits unter der Armutsgrenze. Trotz dieser alarmierenden Situation fliessen horrende Beträge weiterhin ungehindert in die Siedlungen in den besetzten Gebieten, wie die Zeitung "Tachles" am 31. Oktober berichtete. Der israelische Generalstabschef Moshe Yaalon äusserte öffentlich seine Besorgnis über die israelische Militärpolitik und ihre Folgen. Er ist besorgt über die fehlende politische Hoffnung unter den Palästinensern in den besetzten Gebieten und will, dass Massnahmen getroffen werden, um ihre Situation zu verbessern. Yaalon glaubt, dass Israel zur Unlösbarkeit der Situation beiträgt und nicht genug dafür tut, einen Partner innerhalb der palästinensischen Führung zu finden, mit dem man die Teilung des Landes in zwei Staaten realisieren kann.
Schon vorher hatte er den schweren Druck kritisiert, den Israel auf die palästinensische Bevölkerung ausübt, wobei nicht zwischen Terroristen und unschuldigen Menschen unterschieden werde. Es ist ein offenes Geheimnis in Israel, dass viele Militärs im tiefsten Innern grosse Zweifel an der israelischen Kriegspolitik haben. Die kürzlich erfolgte Weigerung einiger Piloten der israelischen Armee, Bomben auf die palästinensische Bevölkerung zu werfen, scheint ein Vorbote gewesen zu sein. Die Militärs wissen, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt und den Terror geben kann. Aber sie haben Angst, dies laut zu sagen, und zögern, die notwendigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. (vgl. "Haaretz" vom 31. Oktober)
Die öffentliche Debatte, die von der israelischen Regierung anschliessend darüber losgetreten wurde, ob ein hoher Militär die Regierungspolitik öffentlich kritisieren darf, könnte auch ein Ablenkungsmanöver sein für die Schwierigkeiten, die Ministerpräsident Sharon mit einer Korruptionsaffäre hat. Er musste letzte Woche vor Gericht erscheinen.
Missfallen Israels an der "Genfer Initiative"
Da die Schweiz als neutraler Staat nicht nur logistisch das Zustandekommen der "Genfer Initiative" unterstützt, sondern auch als Depositärstaat dieses Papiers eine tragende Rolle spielt, brachte das offizielle Israel sein Missfallen über das Schweizer Engagement zum Ausdruck. Die Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey hat den Vorschlag persönlich in den USA präsentiert. Der Leiter der Schweizer Botschaft in Tel Aviv, Claude Altermatt, wurde am Montag letzter Woche vom israelischen Aussenministerium vorgeladen.
Wie Altermatt der Zeitung "Tachles" mitteilte, hat das israelische Aussenministerium seine Bedenken gegenüber der Beteiligung der Schweiz am Zustandekommen der Initiative zum Ausdruck gebracht, und Altermatt habe versucht, diese Bedenken zu zerstreuen. Er sagte, das Gespräch sei "sehr freundschaftlich und in guter Stimmung, wie es zwischen befreundeten Staaten üblich ist," verlaufen. ("Tachles" vom 31. Oktober) Es ist keine diplomatische Note gegen die Schweiz deponiert worden. Die eilige Vorladung des Schweizer Botschafters könnte laut "Tachles" auch damit zusammenhängen, dass in derselben Woche eine Vorstandsdelegation der "Gesellschaft Schweiz - Israel" in Israel auf Besuch weilte. Die Delegation unterhielt sich mit hohen Beamten des Aussenministeriums und "hat diesen gegenüber ihr Unverständnis angesichts der israelischen Nervosität [über die Initiative; Anm. der Red.] klar zum Ausdruck gebracht". ("Tachles" vom 31. Oktober) Angesichts dieser heftigen Reaktion des offiziellen Israel könnte man fast annehmen, es hätte kein Interesse an einem gerechten Frieden für beide Völker! Denn eigentlich sollte doch jede ernsthafte Idee zu einer gerechten und friedlichen Lösung dieses jahrhundertlangen Konflikts mit Freude willkommen geheissen werden.
Inzwischen haben ein israelisches Knessetmitglied der Nationalreligiösen Partei, Shaul Yahalom, ein Rechtsprofessor der Hebräischen Universität, Shimon Shetrit, und andere gefordert, eine Strafuntersuchung gegen die "privaten Unterhändler" und vor allem gegen Yossi Beilin, einen der Hauptinitianten, einzuleiten. Dazu nahm der israelische Generalstaatsanwalt rechtlich eindeutig Stellung: Die Strafgerichte seien nicht der richtige Ort, um Politiker und private Bürger zu bestrafen, die den regierungsunabhängigen Friedensplan mit Palästinensern, als "Genfer Initiative" bekannt, ausgearbeitet haben. Die öffentliche und politische Sphäre sei der geeignete Ort, um solche Angelegenheiten zu diskutieren. Um jedoch die Handhabe der Strafgerichtshöfe zu verstärken, will nun das Knessetmitglied Yuli Edelstein von der Partei Israel BAlyah ein neues Gesetz durchbringen, das solche Friedensaktivitäten als Eigeninitiative von Bürgern verbietet! ("The International Jerusalem Post" vom 31. Oktober)
Schweiz unterstützt weiterhin Lancierung der Friedensinitiative
Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten hat klargestellt, dass die Schweiz trotz der israelischen Kritik weiterhin die Lancierung der Initiative unterstützen wird. Sie soll voraussichtlich am 20. November mit einer Zeremonie in Genf öffentlich gestartet werden. Unter anderen Persönlichkeiten hat auch der frühere US-Präsident und Friedensnobelpreisträger Jimmy Carter seine Teilnahme angekündigt. Die Schweiz bleibt ihrem Engagement der Friedensförderung also treu. Das Papier erfüllt voll die Kriterien für die Unterstützung der Friedenssuche und die Förderung von Menschenrechten durch NGOs. Die Schweiz werde sich bemühen, die Kontakte bezüglich der Initiative mit der Botschaft in Bern und dem Jerusalemer Aussenministerium enger zu gestalten, weist aber darauf hin, dass das Thema schon im Sommer gegenüber höchsten Vertretern der israelischen Aussenpolitik angeschnitten worden sei. ("Tachles" vom 31. Oktober)
EU: "Genfer Papier" ist ein positiver Beitrag
Die EU wertet das "Genfer Papier" als einen sehr positiven Beitrag. Die Initiative zeige, dass es Unterstützung in der israelischen und in der palästinensischen Gesellschaft für die Aufnahme eines Dialogs gebe, sagte Kommissionssprecher Diego de Ojeda. Insbesondere da die "Road Map", als weiterhin offizielles Mittel der Verhandlungen, den Status von Jerusalem nicht berühre, wofür die Initiative Lösungen vorschlage. ("Neue Zürcher Zeitung" vom 29. Oktober) Das "Genfer Papier" wird von Experten als umfassendster und detailliertester Entwurf für einen Frieden im Nahen Osten gelobt. Er behandelt alle heiklen Punkte und schlägt für diese realistische Lösungen vor, darunter den Status Ostjerusalems, einen künftigen palästinensischen Staat, die jüdischen Siedlungen, die Anerkennung Israels und die Flüchtlingsfrage.
Der Text des Papiers steht in keinem Widerspruch zu anderen Friedensinitiativen im Nahen Osten, wie etwa die "Road Map", betonte die Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey. Und Urs Ziswiler, diplomatischer Berater von Calmy-Rey, sagte nach Gesprächen mit US-Vertretern in New York, die US-Regierung sehe die Initiative als Projekt der Zivilgesellschaft. Das Weisse Haus könne und wolle jedoch dazu nicht Stellung nehmen. Gemäss Ziswiler sei die Haltung der USA gegenüber der Initiative entscheidend. Laut Calmy-Rey stiess die "Genfer Initiative" bei den hohen Uno-Vertretern, mit denen sie es diskutiert hatte, auf grosses Interesse.
Auch Ständerätliche Kommission hinter Schweizer Engagement
Die Aussenpolitische Kommission des Ständerates stellt sich grundsätzlich hinter das Schweizer Engagement für die Initiative. Die Bemühungen, den Dialog zwischen Vertretern der israelischen und der palästinensischen Zivilgesellschaft zu erleichtern, werden unterstützt. Es müsse bei den offiziellen Stellen in Israel und in den USA aber klargemacht werden, dass die Schweiz keine Vermittlerfunktion übernehme und zum Inhalt des Abkommens keine Stellung beziehe. ("Neue Zürcher Zeitung" vom 1./2. November)
Gemäss einer Meldung von Radio DRS plant das IKRK die Nahrungsmittelhilfe im von Israel besetzten Westjordanland einzustellen. Gemäss Antonella Notari, Sprecherin des IKRK, ginge es dabei nämlich nicht um ein humanitäres, sondern um ein rechtliches Problem, das Israel lösen müsse. Die vierte Genfer Konvention besage, dass die Besatzungsmacht die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen müsse. Das IKRK, das seit eineinhalb Jahren an die Menschen im Westjordanland Mehl, Öl und Zucker verteilen würde, ist dort zum grössten Lebensmittelverteiler geworden.
Quelle: Radio DRS, Rendez-vous am Mittag, 31.10.2003
Da das "Genfer Papier" am 20. November 2003 in Genf verabschiedet werden und nachträglich an alle Haushalte in Israel und den besetzten Gebieten verteilt werden soll, ist der genaue Wortlaut des Papiers noch nicht bekannt. Vor zwei Wochen hat die israelische Tageszeitung "Haaretz" die Aussagen der wichtigsten Punkte veröffentlicht.
Die Palästinenser verzichten auf das generelle Rückkehrrecht. Einige Flüchtlinge werden in den Ländern bleiben, in denen sie heute leben, andere sind unter der Verwaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde, und manche werden finanzielle Entschädigung erhalten. Einer begrenzten Anzahl soll erlaubt werden, sich in Israel niederzulassen, was aber kein generelles Rückkehrrecht bedeutet.
Die Palästinenser erkennen Israel als den Staat des jüdischen Volkes an.
Israel wird sich in die Grenzen von 1967 zurückziehen, mit Ausnahme einzelner Gebiete, die abgetauscht werden sollen.
Jerusalem soll geteilt werden. Ostjerusalem mit arabischen Quartieren soll Teil des palästinensischen Staats werden. Ostjerusalem mit jüdischen Quartieren sowie die im Westjordanland gelegenen Vororte von Givat Ze'ev, Ma'aleh Adumim und der historische Teil von Gush Etzion - mit Ausnahme von Efrat - sollen zu Israel gehören.
Der Tempelberg soll palästinensisch werden, jedoch soll eine internationale Schutztruppe den freien Zugang für alle Besucher und alle Gläubigen sichern. Weder ist es Juden erlaubt, auf dem Berg zu beten, noch sind dort archäologische Ausgrabungen gestattet.
Die Westmauer bleibt unter jüdischer Verwaltung, und das historische Jerusalem kommt unter internationale Kontrolle.
Die israelischen Siedlungen Ariel, Efrat und Har Homa werden an den palästinensischen Staat zurückgegeben. Zusätzlich gibt Israel Gebiete der Negev, die in der Nachbarschaft von Gaza liegen, ausser Halutza, an die Palästinenser als Ausgleich für die Gebiete im Westjordanland, die Israel erhalten soll.
Die Palästinenser werden sich verpflichten, Terror und Aufruhr zu verhindern sowie die militanten Gruppen zu entwaffnen. Ihr Staat soll entmilitarisiert werden, und die Grenzübergänge sollen von einer internationlen Schutzmacht, aber nicht von den Israeli überwacht werden. Diese Vereinbarung soll alle UN-Resolutionen und frühere Abkommen ersetzen.
Quelle: www.zeit-fragen.ch, Nr.41 vom 3.11.2003 www.haaretzdaily.com
[Übersetzung: Zeit-Fragen]
 rw./yr. Diese steht aber auch sonst unter grossem Druck: Die verfehlte Politik der israelischen Regierung wird in letzter Zeit in Israel unüberhörbar kritisiert, und es gibt Demonstrationen und Streiks wegen der desolaten finanziellen Situation einer grossen Zahl israelischer Bürger. So leben über 300'000 israelische Familien mit rund 600'000 Kindern bereits unter der Armutsgrenze. Trotz dieser alarmierenden Situation fliessen horrende Beträge weiterhin ungehindert in die Siedlungen in den besetzten Gebieten, wie die Zeitung "Tachles" am 31. Oktober berichtete. Der israelische Generalstabschef Moshe Yaalon äusserte öffentlich seine Besorgnis über die israelische Militärpolitik und ihre Folgen. Er ist besorgt über die fehlende politische Hoffnung unter den Palästinensern in den besetzten Gebieten und will, dass Massnahmen getroffen werden, um ihre Situation zu verbessern. Yaalon glaubt, dass Israel zur Unlösbarkeit der Situation beiträgt und nicht genug dafür tut, einen Partner innerhalb der palästinensischen Führung zu finden, mit dem man die Teilung des Landes in zwei Staaten realisieren kann.
rw./yr. Diese steht aber auch sonst unter grossem Druck: Die verfehlte Politik der israelischen Regierung wird in letzter Zeit in Israel unüberhörbar kritisiert, und es gibt Demonstrationen und Streiks wegen der desolaten finanziellen Situation einer grossen Zahl israelischer Bürger. So leben über 300'000 israelische Familien mit rund 600'000 Kindern bereits unter der Armutsgrenze. Trotz dieser alarmierenden Situation fliessen horrende Beträge weiterhin ungehindert in die Siedlungen in den besetzten Gebieten, wie die Zeitung "Tachles" am 31. Oktober berichtete. Der israelische Generalstabschef Moshe Yaalon äusserte öffentlich seine Besorgnis über die israelische Militärpolitik und ihre Folgen. Er ist besorgt über die fehlende politische Hoffnung unter den Palästinensern in den besetzten Gebieten und will, dass Massnahmen getroffen werden, um ihre Situation zu verbessern. Yaalon glaubt, dass Israel zur Unlösbarkeit der Situation beiträgt und nicht genug dafür tut, einen Partner innerhalb der palästinensischen Führung zu finden, mit dem man die Teilung des Landes in zwei Staaten realisieren kann.