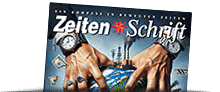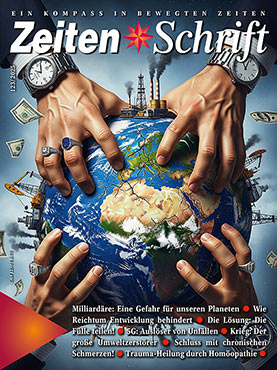Die Amerikanerin Rachel Corrie wurde von einem israelischen Bulldozer absichtlich zu Tode gefahren. Die Amerikanerin Jessica Lynch erlitt als Soldatin schwere Verletzungen im Irakkrieg. Die Art und Weise, wie diese beiden Opfer von Medien und Politik behandelt werden, könnte unterschiedlicher nicht sein - und das aus offensichtlichem Grund. Eine Analyse der amerikanischen Befindlichkeit:
10.10.2005
von Paul Street
Man kann viel über die toxische u. bestimmende Rolle amerikanischer 'Mainstream'-Medien (= Konzern-Staatsmedien) erfahren, indem man dieser Tage einen repräsentativen Querschnitt von Amerikanern zu zwei jungen Frauen befragt, über die jüngst berichtet wurde: Rachel Corrie u. Jessica Lynch. Wer sind die beiden? Was wissen Sie über sie bzw. was denken Sie über sie? Ich wette, der oder die Befragte wird über Jessica Lynch wesentlich mehr wissen als über Rachel - bzw. sich mehr für sie interessieren. Die Gründe hierfür haben viel mit dem erbärmlichen Zustand unserer amerikanischen Zivilisation zu tun - schlecht für die Zukunft der Welt.
"Ich mache mir Gedanken über diese Kinder"
Rachel Corrie starb mit 23 Jahren. Sie starb am 16. März 2003 in der palästinensischen Stadt Rafah, an der Südspitze des Gazastreifens. Rachel studierte am Evergreen State College in Washington. Sie war Senior-Studentin. Sie starb beim Versuch, die Zerstörung eines palästinensischen Wohnhauses zu verhindern. Ein israelischer Bulldozer-Lenker ist ihr Mörder. Mit seinem schweren Gerät fuhr er zweimal über ihren Körper. Rachel war klar zu erkennen gewesen.
Rachel ist nur eines von vielen Opfern, die in Gaza u. Westbank getötet wurden. Sie alle sind Opfer einer rassistischen Besatzung. Es ist diese Besatzung, an der sich im Pulverfass Nahost der Hass der arabischen Welt am mit Abstand vehementesten entzündet. Aber Rachel war die erste tote Ausländerin, die in Palästina starb, als sie gegen israelische Aktionen protestierte. Evergreen: "Rachel war ein leuchtender Stern, eine tolle Studentin, eine mutige Person mit tiefen Überzeugungen".
Evergreen ist ein College, das sich dem konservativen Trend amerikanischer Hochschulen entgegenstellt. Hier wird Studierenden Engagement für Unterdrückte beigebracht - für Unterdrückte im In- u. Ausland. Auf welch hohem Niveau sich Rachels Denken abspielte, wieviel man ihr vermittelt hat, kommt in einer E-mail-Botschaft zum Ausdruck, die sie fünf Wochen vor ihrem Tod schrieb. Ein Abschnitt dieser Mail setzt sich mit der unterschiedlichen Lebenssituation von Amerikanern u. Palästinensern auseinander, vor allem aber mit der Lebenssituation palästinensischer Kinder, die unterm eisernen Stiefel eines der führenden Terror-Klienten-Staaten der USA leben müssen:
"Ich hätte noch viel mehr darüber lesen, noch viel mehr Konferenzen besuchen können, mir Dokus anschauen oder mit Leuten reden - nichts hätte mich auf die Realität dieser Situation hier vorbereitet. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, wenn man es nicht sieht. Und selbst dann ist einem klar, was du hier erlebst, hat noch nichts mit der wahren Realität zu tun. Denn - was für Schwierigkeiten würde die Israelische Armee wohl erwarten, wenn sie einen unbewaffneten Bürger der USA erschießt? Ich habe Geld, ich kann mir Wasser kaufen, wenn die Armee die Brunnen zerstört. Und natürlich bleibt mir immer noch die Option, wieder zu gehen. Keiner in meiner Familie wurde je in seinem Auto erschossen, weil ein Raketenwerfer ein Geschoss auf das fahrende Auto abfeuerte.
In meinem Stadtviertel gibt es am Ende der Hauptstraße keine Raketenwerfer, die von einem Wachturm aus Geschosse abfeuern. Ich habe ein Zuhause. Mir steht es frei, den Ozean zu sehen. Und offensichtlich wäre es bis zu diesem Zeitpunkt schwierig, mich ohne Anklage monate- oder jahrelang einzusperren (schließlich handelt es sich bei mir um eine weiße US-Bürgerin). Wenn ich zur Schule oder zur Arbeit gehe, weiß ich relativ sicher, dass mich zwischen Mud Bay u. der Unterstadt von Olympia kein Checkpoint mit einem schwerbewaffneten Soldaten erwartet - ein Soldat, der die Macht besitzt, zu entscheiden, ob ich mein Tagwerk verrichten darf beziehungsweise ob ich anschließend wieder nach Hause darf.
Ich empfinde einen solchen Zorn während dieser kurzen, nur oberflächlichen Stippvisite in die Welt dieser Kinder. Und dabei frage ich mich, wie diese Kinder wohl umgekehrt empfinden würden, wären sie plötzlich in meine Welt versetzt. Die Kinder hier wissen, amerikanischen Kindern schießt man normalerweise nicht die Eltern tot. Und sie wissen, ab und zu können unsere Kinder auch den Ozean sehen. Aber wenn diese Kinder nun den Ozean sähen und eine Zeitlang an einem ruhigen Ort lebten, an dem Wasser eine Selbstverständlichkeit ist und einem nicht bei Nacht mittels Bulldozern gestohlen wird, wenn sie einen Abend verbrächten, ohne sich dauernd zu fragen, wache ich heute Nacht plötzlich auf, und die Mauern meines Hauses fallen auf mich, wenn sie Menschen getroffen hätten, die noch nie jemanden verloren haben - wenn sie die Realität einer Welt erlebten, die unumzingelt ist von Killertürmen, Panzern, bewaffneten 'Siedlungen' - und nun auch noch diese riesen Metallmauer - ich frage mich, könnten sie der Welt dann noch vergeben, dass man sie eine ganze Kindheit lang in dieser Situation hat vegetieren lassen - es ist ja nur ein Vegetieren -, eine Situation, die darauf abzielt, sie aus ihrem Zuhause zu vertreiben? Diese Frage bewegt mich, wenn ich die Kinder hier sehe. Ich frage mich, was wäre, wüssten sie wirklich Bescheid".
Rachel konnte ihren Batchelor-Aschluss nicht mehr machen, aber rein moralisch-intellektuell war sie all jenen akademisch-betitelten Verteidigern, Planern u. Propagandisten von Rasse-"Kriegen" und Imperien haushoch überlegen. Ihre mutige Fähigkeit zu kritischem Denken u. ihr aktives moralisches Engagement hat sie sicherlich von daheim mitgebracht. Darin spiegeln sich Rachels Familienwerte. Aber ebenso spiegeln sich darin auch Lernprozesse, die ihr in den unteren Klassen von Evergreen vemittelt wurden.
Rachels Vater: "Wir haben versucht unseren Kindern beizubringen, sie seien ein Teil jener Gemeinschaft, der alle Menschen auf Erden angehören". Er ist von Beruf Versicherungsstatistiker - nicht unbedingt der typische Beruf für einen liberalen, linken Mittelschichts-"Kriegs"-Gegner (die von US-Rechten ja für gewöhnlich als überprivilegierte "Unamerikaner" geschmäht werden). In den "Mainstream"-Medien Amerikas hat man den Mord an Rachel nur beiläufig erwähnt. Und als der "Krieg" gegen Irak losbrach, wurde ihre Geschichte sofort ausgeblendet. Natürlich war Rachel Kriegsgegnerin.
"Saving Private Lynch" - über die Zelebrierung einer 'entbehrlichen' Amerikanerin
Die Medienberichterstattung bezüglich der befreiten Kriegsgefangenen Pfc. Jessica Lynch verlief völlig anders als bei Rachel. Vor dem "Krieg" hatten die beiden Frauen einiges gemeinsam: Sie waren jung, blond, hübsch, sie wollten die Welt sehen, sie liebten Kinder (bevor Jessica sich entschloss, zur Armee zu gehen, wollte sie Kindergartenlehrerin werden), und beide wurden für ihre Tatkraft bewundert. Aber damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon. Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden jungen Frauen: Jessica ist etwas jünger, 19, damit könnte sie noch keine College-Oberstufe besuchen. Und sie stammt aus einer Arbeiterfamilie (ihr Vater ist Lastwagenfahrer im Nichtangestelltenverhältnis).
Grusligerweise lebt die Familie ausgerechnet in einem kleinen Ort in West-Virginia namens Palestine (Palästina). Anders als Rachel stand Jessica keine der klassischen Mittelklasse-Optionen zu Karriere u. Erfolg offen, sie hatte keinen Zugang zur Welt des kritischen Denkens u. Forschens - zur wahren Geschichte der amerikanischen Außenpolitik. Jessica gehört zu jener Sorte Amerikaner, die in den Augen der Superreichen - George W. Bush, Donald Rumsfeld, etc. - 'entbehrliche' Opfer sind, auf dem Weg dieser Superreichen zu imperialer Expansion. Wie viele andere junge Amerikaner ihrer sozio-ökonomischen 'Kohorte' ging auch Jessica zur Armee - sie wollte mehr als nur einen schnellen Job. Die Ränge der US-Armee sind gespickt mit Leuten aus der Arbeiterschicht. Jessica versuchte, finanzielle Unterstützung für einen College-Besuch zu erhalten. Sie wollte jenen Abschluss, der unverzichtbar ist, wenn man bei uns in den USA einigermaßen anständig leben will. Nicht umsonst sind die USA die ungleichste Gesellschaft in der industrialisierten Welt. Militärdienst ist der Preis, den viele Amerikaner dafür zahlen, dass sie in eine untere Schicht unserer hierarchischen amerikanischen Gesellschaft hineingeboren wurden - siehe Jessica. Wie hat es jene Ketzerin aus West-Virginia ausgedrückt: "hier in West-Virginia haben wir die höchste Armeerekrutierungs-Quote pro Kopf, verglichen mit allen anderen Bundesstaaten. Ich finde, das spricht Bände über die Chancen, die unsere Wirtschaft jungen Leuten aus der Region bietet. Nicht mal in den Kohlenminen gibt es noch allzuviele Jobs. Jessica gehörte zu den Hoffnungsträgern, zu jenen, die versuchten, an die nötige Bildung und Ausbildung zu kommen, um dann irgendwann wieder in ihre geliebte Heimat in den Bergen zurückzukehren. Sie hat wohl mehr bekommen, als sie wollte - in jeder Hinsicht". (Anne Tatelin: 'The Gospel According to Jessica Lynch')
Der Preis, den Jessica u. ihre Kameraden von der 507ten Wartungskompanie der US-Army zahlten, war folgender: Am 23. März 2003 fand sich die Kompanie plötzlich hinter "feindlichen" irakischen Linien eingeschlossen wieder. Das war eine Woche nach Rachels Ermordung. Es kam zum Kampf, wobei Jessica multiple Verletzungen erlitt. Unter anderem wurde sie am Kopf verletzt, am Rückgrat, beide Beine, ihr rechter Fuß, ihr rechtes Fußgelenk sowie ihr rechter Arm wurden gebrochen. Sie musste mehrfach operiert werden. Seit dem Tag ihrer Rettung wird Jessica gefeiert wie eine echte Nationalheldin. Man hat ihr sogar College-Stipendien angeboten. Man ehrt sie, weil sie ihre irakischen Gegner mit Blei vollpumpte, bis sämtliche Waffen leer waren.
'People Magazine' hat ihr eine Titelgeschichte gewidmet, ein 'A&E'-TV-Special unter dem Titel: 'Saving Private Lynch' (Die Rettung der Soldatin Lynch) wurde gesendet. Sicher wird es auch Bücher u. Kinofilme geben, werden die Konzern-Mogule Jessica Lynch lukrative Verträge zur Vermarktung ihres Lebens und Leidens anbieten (Mega-Publisher HarperCollins hat bereits einen Buchvertrag mit jenem irakischen Anwalt angekündigt, der zur Rettung Lynchs beigetragen haben soll: (Mehr dazu unter
http://www.abclocal.go.com/wpri/news/5903-iraqlynch.html).
Aber wie hoch die finanzielle Kompensation auch ausfallen wird, sie wird immer noch zu niedrig sein, um das zu kompensieren, was Jessica widerfuhr - in Diensten der Imperial-Phantasie von Bush, Rumsfeld und der anderen Drückeberger-Kriegsherren (Chicken Hawk Masters of War), die, wie Bob Dylan in seinem 'Masters of War' vor 40 Jahren sang, "sich in ihren Villen verkriechen", "während das Blut junger Leute aus ihren Körpern rinnt und in Dreck beerdigt wird".
Mittlerweile sind die Masters im Weißen Haus schon eifrig dabei, Jessicas Story für ihre innenpolitischen Zwecke zu nutzen. Perverserweise fasziniert die Konzern-Plutokratie der Bush-Administration gerade Jessica Unterschichts-Herkunft am meisten. Dieser Hintergrund macht sich gut bei 'Dubyas'* verlogenem Versuch, uns seine regressive Innenpolitik - Steuererleichterungen für Superreiche sowie Sozialkürzungen für Arme bzw. für uns alle - als volkstümliche Geste an den 'kleinen Mann' zu verkaufen.
Würdige und unwürdige Opfer
Wer die Orwell'schen Machenschaften von Weißem Haus, Pentagon u. US-Konzern-Staats-Medien wirklich hinterfragt, den dürfte wohl kaum überraschen, dass die tragische Geschichte von Rachel Corrie in unserer Konzern-"Pop-Kultur" mehr u. mehr auf dem Müllhaufen der Geschichte versickert. Jessicas erschütternde Story hingegen wird monatelang im hellen Scheinwerferlicht bleiben. In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich auf das Zweite Kapitel von Noam Chomsky und Ed Hermans bahnbrechendem Buch: 'Manufacturing Consent: The Political Economy of The Mass Media' verwiesen, 1988 bei Pantheon, New York, erschienen. Das Zweite Kapitel trägt die Überschrift: 'Würdige und unwürdige Opfer'. Dieses Buch erschien, als der Kalte Krieg kurz vor seinem (partiellen) Ende stand.
Die Sowjetunion - Abschreckungsgegner der amerikanischen Globalambitionen - war damals gerade am kollabieren. "Ein Propagandasystem", so die Autoren, "wird Menschen, die in feindlichen Staaten misshandelt werden, immer als würdige Opfer darstellen, während diejenigen, die von der eigenen Regierung bzw. deren Klientenstaaten gleich übel oder noch übler misshandelt werden, angeblich unwürdig sind".
Die unterschiedliche Art, wie unsere Medien nun mit der Geschichte von Rachel bzw. der von Jessica umgehen, legt nahe, dass diese Analyse auch in der "Ära nach dem Kalten Krieg" noch zutrifft - was 'Opfer' in Amerika aber auch andernorts angeht. Die Rachel-Jessica-Dichotomie (Zweiteilung) ist wohl kaum das einzige Beispiel einer nach wie vor aktuellen propagandistischen Distinktion zwischen 'würdigen' und 'unwürdigen Opfern', wie sie in den US-Medien in letzter Zeit häufig anzutreffen ist. Erinnern wir uns: Als es amerikanische Bomben auf unschuldige Afghanen hagelte - in jener Anfangsphase von George Bushs 'Krieg gegen den Terror' nach dem 11. September -, publizierten New York Times u. andere Zeitungen sehr persönliche u. ausführliche Nachruf-Stories über einzelne Opfer der Anschläge vom 11. September.
Schließlich sind sie die ultimativ würdigsten aller offiziellen Opfer unserer amerikanischen Geschichte, oder nicht? (Wobei es Millionen afro-amerikanischer Sklaven bzw. die vergessenen Ureinwohner Amerikas mindestens ebenso verdient hätten, dass ihrer auf ehrliche u. antirassistische Weise gedacht wird.) Die Presseberichte waren sensibel gehalten, respektvoll u. erschütternd, aber warum sahen es die großen amerikanischen Medien nicht als ihre Pflicht an, etwas vergleichbar Persönliches auch über die tausenden afghanischen Zivilisten zu schreiben, die ihr Leben aufgrund von Amerikas Krieg gegen Taliban u. Al-Kaida verloren - als 'Kollateralschäden'?
Und was den jetzigen "Krieg" angeht: Durch "ihre" Medien erfahren die Amerikaner derzeit eine Menge über die früheren kurdischen u. iranischen Opfer Saddams bzw. über die Gasaktionen gegen sie (denen die USA zugestimmt hatten). Worüber Amerikaner allerdings praktisch nichts erfahren, sind die vielen palästinensischen Opfer Israels - die derzeitigen u. die etwas älteren. Allein seit dem 11. September 2001 wurden dort 2 000 Menschen getötet.
Dank der einseitigen US-Berichterstattung u. -Kommentierung erscheint die Situation der Palästinenser uns Amerikanern als völlig mysteriös, ein sinnvoller Kontext ist in keinster Weise herzustellen. Und noch etwas: Die Amerikaner bekamen zwar Szenen toter oder verletzter irakischer Zivilisten zu sehen, die einem zu Herzen gehen sollten (wobei die wirklich schrecklichen Szenen herausgefiltert wurden, da man die potentielle öffentliche Wirkung in Amerika u. weltweit fürchtete). Die erschütternden Lebensgeschichten unschuldiger irakischer Opfer, die bei der US-Invasion umgekommen sind, zeigt man allerdings überhaupt nicht. Über sie kann man weder lesen noch hören. Ganz anders der Umgang mit unseren amerikanischen Gefallenen bzw. mit US-Kriegsgefangenen. Sie rückt man sowohl national als auch auf lokaler Medienebene ins grelle Rampenlicht, läßt ihnen Ehre zuteil werden.
Aber im Grunde tragen die Medien überhaupt erst die Schuld daran, dass Leute wie Jessica u. ihre 'entbehrlichen' US-Kameraden in die irakische Bredouille gerieten; genau diese Medien hatten nämlich pflichtschuldigst die 'Große Bush-Lüge' verbreitetet - jene absurde Vorstellung (die niemand außerhalb der USA je geteilt hat), Saddam stelle eine ernsthafte Gefahr für Amerika und die Welt dar. Wen wundert's. Bis heute hat es das amerikanische Konzern- Unterhaltungs- und Kommunikationsimperium ja auch verstanden, der US-Bevölkerung zu suggerieren, der Vietnamkrieg sei in erster Linie ein Drama der amerikanischen Psyche. Dass die Vietnamesen Millionen Tote zu beklagen hatten war der Preis für ihren Kampf gegen die Invasionsarmee der mächtigsten Nation auf Erden.
Die amerikanischen Verluste in Vietnam - vor allem unsere 58 000 Toten - betrafen in erster Linie arme amerikanische Familien bzw. Arbeiterfamilien - in unproportionalem Maße. Aber weder absolut noch relativ, sind diese Opfer irgendwie mit den Verlusten auf vietnamesischer Seite zu vergleichen. Das vietnamesische Volk hat viel mehr gelitten.
Es schmerzt zu töten: "Ich hatte das Gefühl, etwas zu tun, von dem der Herr sagt, man darf es nicht". "Da ist dieses Bild in meinem Kopf, das ich nie mehr loswerde".
Es passt zu unserm pervers-narzistischen US-Vietnam-Syndrom, dass Reporter in ihrer Berichterstattung über 'Operation Freiheit für Irak' das Genre des sensiblen Berichts (über den schwierigen Umgang unserer Soldaten mit ihrem emotionalen Trauma im Zusammenhang mit der Tötung von Irakern) bemühen.
Gleich zu Beginn des "Kriegs" erschien in der New York Times ein Artikel mit dem Titel: 'Haunting Thoughts After a Fierce Battle' (Gedanken, die einen nach einer harten Schlacht verfolgen). Darin wird berichtet, wie ein gewisser Sergeant Mark N. Redmond nach Tötung einer ungenannten Zahl Iraker in die moralische Sinnkrise gerät. Die Iraker hatten es gewagt, ihr Heimatland gegen die Invasion einer überlegenen amerikanischen Streitmacht zu verteidigen. "Ich hab' Frau und Kinder, zu denen ich heimkehre", so Redmond gegenüber Times-Reporter Steven Lee Myers. "Ich will nicht, dass die mich für einen Killer halten". Und Myers: Redmond "scheut sich", "Details der tödlichen Wirkung seines Waffengebrauchs zu schildern".
Der Artikel endet mit dem Kommentar des Armee-Geistlichen Mark B. Nordstrom, der einer eigentlich pazifistischen Mennoniten-Konfession angehört. Nordstrom sagt, die amerikanischen Truppen hätten in den "letzten paar Tagen" "Tausende getötet". Dann fährt dieser 'pazifistische' Geistliche mit der Bemerkung fort: "Nichts kann dich darauf vorbereiten, ein anderes menschliches Wesen zu töten. Nichts kann dich darauf vorbereiten, eine Maschine zu gebrauchen, um einen andern in zwei Stücke zu teilen." Und weiter, US-Soldaten seien "sehr bekümmert", "wenn sie töten müssten, besonders so nah".
Anscheinend fällt es der Seele leichter, aus 30 000 Fuß zu killen oder aus dem klimatisierten Planungsbüro einer Raketenbasis heraus - es muss nur weit genug vom Schuss sein. "Sie wollen mit mir reden", so Nordstrom zu Myers, "sie wollen mich wissen lassen, dass sie keine schlimmen Menschen sind".
Noch schauderhafter die Story im Wall Street Journal vom 11. April 2003. Kriegsberichterstatter Michael M. Phillips hat sie der Welt geschenkt. Phillips schildert darin, wie eine Gruppe Marines in den Ruinen der Angestellten-Cafeteria des irakischen Öl-Ministeriums zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch im Kreis zusammenhockt. So beschreibt uns der Journalist beispielsweise die Ängste von Marine-Korporal James List, 21, der "befürchtet, folgende Szene könnte ihn den Rest seines Lebens verfolgen: Ein etwa 20-jähriger glattrasierter Iraker in weißem Hemd liegt verwundet in einer Gasse. Er will nach seinem Gewehr greifen - da pumpt ihm Korporal List zwei Kugeln in den Kopf. "Jedesmal, wenn ich jetzt die Augen schließe, sehe ich diesen Kerl vor mir, wie sein Gehirn aus seinem Schädel platzt (...) Dieses Bild steckt so tief in meinem Kopf, das werde ich nie mehr los"".
Und ein anderer Marine, den Philips interviewt, berichtet "von einem komischen Gefühl"; er hatte einen verwundeten Iraker in den Hinterkopf geschossen, es sei " so gewesen", hätte "Seargant Pierre" nachdenklich gesagt, "wie wenn ich was getan hätte, das unser Herr in der Bibel ausdrücklich verboten hat". Pierre hatte auch die übliche "Augen-Bohrer"-Methode angewendet, mit der amerikanische Soldaten sicherstellen, dass der frisch getötete Feind auch "wirklich tot" ist. Sie stecken ihm den Lauf des Gewehrs ins Auge. Zuerst sei Korporal Anthony Antista eigentlich zum Feiern zumute gewesen, als er zwei irakische Soldaten erschossen hatte. "Aber der Jubel ist bald verflogen, dann kam das Schuldgefühl hoch".
Seine Kameraden hätten ihn missverstanden, als er ihnen ständig mit "hey, ich hab' zwei Leute erschossen" in den Ohren lag, sie hätten geglaubt, er wolle sich mit dieser Tat "brüsten". "Was er aber eigentlich wollte", so Phillips, "war jemanden finden, der begreifen würde, wie schlecht es ihm ging".
Sterbende Araber wie zuckendes Wild: "Das ging vorbei, dann schoss ich weiter auf den Kerl ein".
Laut Phillips haben die erwähnten Soldaten von Bushs Invasionstrupp "gerade erst mit der Aufarbeitung ihres psychischen Schmerzes begonnen", den die Ärmsten erlitten, "als sie (massenhaft!) töteten" - nämlich Zivilisten und Soldaten in einem armen und praktisch wehrlosen Land. Aber einigen aus der Cafeteria-Runde scheint die Erfahrung erstaunlich gut bekommen zu sein. Am übelsten in Phillips Artikel der Beitrag von "Leutnant Moore, 26". Moore "versuchte, seine Leute zu trösten, indem er von seinen persönlichen Erfahrungen als Jäger sprach. Er wuchs in Wasila, Alaska, auf". Der Abschnitt, in dem Phillips über Moore schreibt, ist es wert, ausführlich zitiert zu werden. Darin heißt es, Moore...
"...schoss sein erstes Karibu, als er 7 oder 8 war, so erzählt er ihnen. Es sei aufregend gewesen, zu sehen, wie das Tier umfällt. Als er jedoch näher kam, sah er, dass das Karibu noch lebte und in Schmerzkrämpfen zuckte. Also wusste der Junge erstmal nicht, soll er sich gut oder schlecht fühlen. Er hat jahrelang Karibus, Bären und andere Tiere gejagt. Tod und Augenbohren wurden für ihn zur Routine. Als Leutnant Moore von einer Treppe in einem Bagdader Gebäude herunter drei Iraker liegen sah, handelte er, ohne zu zögern.
Die Männer waren durch Maschinengewehrfeuer verletzt, sie rührten sich aber noch (Anmerkung: vielleicht haben sie gezuckt wie frisch erlegtes Alaska-Wild). Der Leutnant erschoss einen Mann aus nächster Nähe und beobachtete das Resultat. Ein zweiter zuckte und bekam die gleiche Behandlung. "Schon hart, aber es ist so", sagt der Leutnant zu seinen Marines. "Dieses mulmige Gefühl, das hab' ich nie gehabt".
Glaubt man Phillips kaltschnäuzigem Bericht, ist neben Moore auch Marine-Seargant Timothy Wolkow so ein knallharter Typ. Wolkow, 26, berichtet von einem "mulmigen Gefühl" gleich zu Beginn, als er zum erstenmal einen Iraker erschoss. "Aber das ging weg", so Wolkow, "und ich hab' dem Kerl noch ein paar verpasst". Ich frage mich:
Hatte jener Bulldozerfahrer, der Rachel Corrie tötete, auch so "ein mulmiges Gefühl", als er zum erstenmal über sie gefahren ist? Wenn ja, ging die Übelkeit schnell vorüber. Er legte den Rückwärtsgang seiner Maschine ein und hat ihr "noch eine verpasst". Vielleicht wäre es ja eine gute Idee, das Pentagon davon zu überzeugen, den Israelis ein paar Geistliche oder Gruppentherapie zur Verfügung zu stellen - damit auch jenem sicherlich bedauernswertem Opfer geholfen wird, das ein "unwürdiges" Opfer töten musste, weil es sich der rassistischen Aggression im Nahen Osten entgegenstellte.
Bescheidener Vorschlag
Gott weiß, wie wichtig es ist, Kriegsveteranen, die aus dem Irak heimkehren, zu therapieren - besonders die Moores u. Wolkows unter ihnen. Das sind die eigentlich problematischen Fälle unter den Soldaten - diejenigen, denen ihre Aufgabe im Irak nicht (nachträglich) zu schaffen macht. Man könnte heimkehrenden Veteranen aber auch ein Stipendium am Evergreen State College verschaffen bzw. an einer anderen Hochschule, an der sie etwas über US-Außenpolitik erfahren. Warum sie nicht an ein Institut schicken, das ihnen reinen Wein über das anti-demokratische Zustandekommen u. die wahren Absichten unserer Außenpolitik einschenkt (es gibt allerdings nicht sehr viele Einrichtungen dieser Art im Bereich unserer "höheren Bildung")?
Eine lohnende Investition - denn dadurch würden unsere Veteranen mit der Zeit so befähigt wie Rachel Corrie u. deren Rolle übernehmen. Vielleicht würden sie sich dann, wie Rachel, als Ersatz für Leute hinstellen, die man zu offiziellen Staatsfeinden erklärt hat, vielleicht würden sie sich George Bush in den Weg stellen bzw. dessen Entschluss, einen permanenten Krieg gegen die arabische Welt u. gegen künftige "unwürdige" Opfer des American Empire zu führen. Aber keine Gruppe hätte eine Nacherziehung in diesem Sinne wohl so nötig wie die Besitzer, Manager u. (führenden) Mitarbeiter unserer amerikanischen Konzern-Staats-Medien. Nicht zuletzt ihnen ist es zu verdanken, dass diese neue schreckliche Welle des US-Imperialismus über uns hereinbrach - im Grunde reiten sie sie sogar. Und was George Bush selbst anbelangt. Er hat in Yale im Hauptfach Geschichte belegt. Wie er darin abgeschnitten hat, dürfte wohl klar sein.
Der Autor, Paul Street, (pstreet@cul-chicago.org) ist 'Urban Social Policy Researcher' in Chicago.
Anmerkung d. Übersetzerin
* Dubya meint das 'W' ('doubleuh') in George Walker Bush
Übersetzt von: Andrea Noll
Quelle: ZNet 12.05.2003
Orginalartikel:
"Rachel Corrie, Jessica Lynch, And The Unequal Worthiness Of Victims"