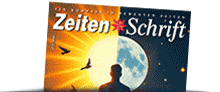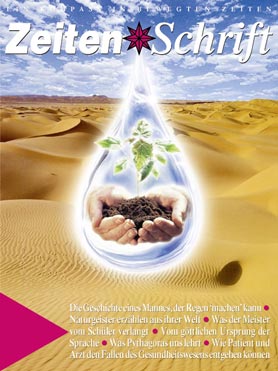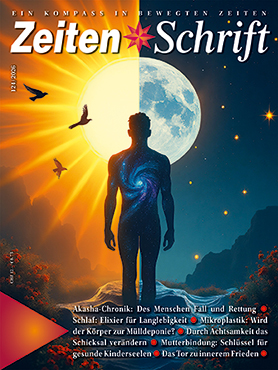Der Mann, der Regen machen kann
Hans Hangartner (82) hat den Schlüssel zu einem der großen Klimaprobleme gefunden: Er weiß, wie man der Natur helfen kann, dort wieder Regen zu erzeugen, wo er immer war, bevor der Mensch dies vereitelte. Hans Hangartner hat nur ein Problem: Man will seine Dienste nicht - obwohl er's schon viele Male erfolgreich hat regnen lassen.
Wie ernährt man alle Menschen?
Mit zwanzig Jahren, so um das Jahr 1941, hatte Hans Hangartner sein Schlüsselerlebnis. Er betrachtete eine Liste der Länder der Erde. Auf ihr war der Bevölkerungszuwachs seit dem Jahr 1800 verzeichnet. Ein ungeheurer Zuwachs. Die Zahlen ließen Hangartner schaudern. "Wie wird es uns nur gelingen, diese ständig zunehmenden Massen an Menschen zu ernähren?" fragte sich der junge Mann. Eine Frage, die ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen sollte, und auf die ihm gleich eine Antwort kam: "Wir müssen die Wüsten wieder begrünen." Diese riesigen Ödflächen vermöchten, so war sich Hangartner gewiß, für lange Zeit jedes Nahrungsproblem zu lösen, wenn es gelänge, sie in fruchtbare ‚Gärten' zu verwandeln.
Schwärmerische Gedanken eines Jünglings, mögen Sie nun denken. Das faszinierende an Hangartner ist aber, daß er nicht wie Millionen andere dachte, "schön wär's, aber unmöglich ist's", sondern daß er sich vornahm, dieses Problem zu lösen: Die Wüsten wieder grün zu machen. "Ich glaubte felsenfest daran, daß ich es könnte. Niemals ist mir der Hauch eines Zweifels gekommen", sagt der sanfte alte Mann.
Nun war er nicht etwa der begünstigte Sohn eines Naturwissenschaftlers, der in den Fußstapfen seines Erzeugers ging und gerade ein Elitestudium absolvierte, als er sich vornahm, die Lösung für das Nahrungsproblem zu finden. Im Gegenteil. Eine richtige Lehre machte er zeitlebens nie - was eigentlich eine Lüge ist, denn Hangartner funktionierte kurzerhand sein ganzes Leben zu einer einzigen großen Lehre um. "Wenn mich etwas interessierte, wenn ich etwas neues lernen wollte, dann habe ich mich einfach um eine Stelle in dem betreffenden Fachgebiet beworben", sagt er lächelnd, als ob dies das natürlichste der Welt wäre. Und er bekam die Stellen auch; arbeitete in einer Glasbläserei, einer Kunstseidenfabrik, bei ‚Saurer Arbon', bei einer Kugellagerfabrik, beschaffte sich dann eine Stelle in der Werkstatt einer Baufirma, um Erfahrungen mit der Hydraulik zu gewinnen, und beendete seine Arbeitsjahre schließlich als ebenso erfinderischer wie hoch geachteter Maschinenkontrolleur.
Hangartners Jugendjahre mögen mit dazu beigetragen haben, daß er seinen erstaunlichen Weg abseits der ausgetretenen Pfade beschritt. "In der Not findet man viel mehr Wege, um zu überleben", sagt er und spielt auf die Hungerjahre an, die er als Zehn-, Zwölfjähriger in der Schweiz erlebte, und wo man froh sein konnte, wenn die Mutter aus ein paar im Wald gesammelten Huflattichblättern, ein wenig Milch und einigen Kartoffeln eine sättigende Suppe kochen konnte. Die Erfahrung des Hungers war für den jungen Hans um so einschneidender, als sie so abrupt kam - und, gewissermaßen, nach der Vertreibung aus seinem Paradies der Kindheit.
Geboren wurde Hangartner nämlich als Sohn einer Rumänin und eines ausgewanderten Schweizer Melkers im rumänischen Siebenbürgen. Das war damals schon ein eher armer Landstrich, dafür reich an unberührter Natur und an persönlicher Freiheit. Unvergeßlich, wenn er in den warmen Sommernächten mit seinem Vater im ‚Heuschöchli' auf freiem Feld übernachten konnte und Sternbilder am schwarzen Himmel bestaunen, bis ihn sanft der Schlaf übermannte. Unvergeßlich auch, wie man mit bloßen Händen in den sprudelnden Bächen ganze Körbe voll dicker, gut genährter Fische fangen konnte. Ein wenig trauert der alte Mann jenen innigen, geborgenen, verheißungsvollen Kinderjahren immer noch nach - einer Zeit und einem Leben, die ihn lehrten, daß man auch mit wenig erfüllt und glücklich sein kann.
Der Großvater wollte aber unbedingt, daß die Familie in die Schweiz zurückkehre - und so tat man es halt, auch wenn Rumänien dem tüchtigen, aufrechten Vater nicht nur die rumänische Staatsbürgerschaft, sondern auch eine solide Staatsstelle angeboten hatte. In der Schweiz dann der Schock der Krisen- und Hungerjahre. 1936 unternahm die Familie noch einmal den Versuch, woanders mehr Glück zu finden, und wanderte nach Böhmen aus; "damals die Gegend mit dem zweithöchsten Lebensstandard Europas", erinnert sich Hangartner. 1938 riet dann aber die Schweizer Botschaft den Hangartners, sich lieber heim in die sichere Schweiz zu begeben, weil sich von Deutschland her Ungutes zusammenbraue. So kam Hans dann als Siebzehnjähriger ‚definitiv' in die Schweiz zurück - jenes Land, das dank seines Wasserreichtums auch das ‚Wasserschloß Europas' genannt wird, und dessen Bewohner mißmutig über das ‚schlechte Wetter' stöhnen, wenn wieder einmal ein paar Tage Regen fällt.
Gibt es schöneres als Regen?
Keinem Bewohner von Mauretanien, von Namibia, von Mali oder Indien fiele es ein, Regen als ‚schlechtes Wetter' zu bezeichnen. Regen bedeutet für diese Menschen Leben, sein Ausbleiben Tod. Regen ist ein Anlaß zu Freudentänzen und Dankgebeten, nicht zu muffeliger Miene und düsterer Laune.
Irgendwann in den Jahren seiner Studien kam Hangartner zum Schluß, daß man dem Dürreproblem der Wüstenrandzonen nicht abhelfen könne, indem man das Gebiet einfach bewässere, weil dann die Böden aufgrund des Salzes, das auch in ‚normalem' Süsswasser enthalten ist, mit der Zeit versalzen. Abgesehen davon - woher sollte man in der Sahelzone südlich der Sahara schon diese Mengen von Wasser holen? Das einfachste, erkannte Hangartner, wäre, man würde es dort einfach regnen lassen.
Ein Gedanke, auf den vor ihm auch schon andere gekommen waren, und für dessen Verwirklichung - nämlich das ‚Regen machen' Hunderte von Millionen Dollar ausgegeben worden waren - mit eher kläglichen und fragwürdigen Ergebnissen. Seit den Vierziger Jahren unternahm man Experimente mit dem sogenannten ‚Wolken impfen'. Das bedeutete, daß man eine regenschwangere Wolke zu verleiten versuchte, ihr Wasser auszuregnen. Dazu streut man aus Flugzeugen Silberjodkristalle über sie aus. Diese bilden dann Kondensationskerne, um welche sich Wassermoleküle sammeln. Wenn der Kern samt seiner Wasserumhüllung zu schwer wird, fällt er als Tropfen zur Erde. Allerdings konnte das Vorhaben nur gelingen, wenn ‚richtige' Wolken bereits über dem dürren Gebiet waren, und wenn sie einen ganz bestimmten Grad von Unterkühlung aufwiesen. Zudem handelte es sich doch um einen chemischen Eingriff in Naturvorgänge, und dieser hat immer irgendwelche unerwünschte Nebenwirkungen.
Die wahre Lösung des Regenmachens mußte viel einfacher sein, sagte sich Hangartner. Und er begann, die Natur zu studieren. Bildete sich im Selbststudium auf dem Gebiet der Thermik und der Verdunstungsphysik aus, studierte Unmengen von Wetterkarten, auf welchen die Wind- und Meeresströmungen und andere charakteristische Wetterdaten verzeichnet waren. Wetter ist das Produkt eines globalen Ganzen, und wenn irgendwo das Gleichgewicht verschoben wird, dann zeigt dies Auswirkungen weltweit. Überall machte Hangartner seine Beobachtungen und zog Schlußfolgerungen daraus. Beispielsweise, als er einmal im November in den Wassern der Karibik badete und das Wasser 30 Grad warm war: "Wassertemperaturen von über 27 Grad führen zu Hurrikanen", führt er aus, als wäre es genauso naheliegend und selbstverständlich, wie daß man im Regen naß wird. Die Erwärmung der Meere hat aber weitere fatale Folgen, erläutert er: "Erwärmtes Wasser dehnt sich auf alle Seiten aus und fließt daher - beispielsweise im Golfstrom - schneller. So gelangt durch dieses schnelle Fließen mehr Salzwasser zum Nordpol. Dieses löst einen Teil des Eises auf. Zwischen Grönland und Alaska gibt es ein Gebiet mit offenem Wasser, das nun mit großen Mengen Schmelzwasser ‚überschwemmt' wird. Da Schmelzwasser leichter ist als Meerwasser, schwimmt es oben und gefriert nun zu. Also wird die Wärmeabstrahlung des einstmals offenen, nun zugefrorenen Meeres geringer, und plötzliche, starke Kälteeinbrüche auf dem amerikanischen Kontinent sind die Folge. Es wird dadurch auch in der Stratosphäre kälter, was gefährlich ist, denn ab minus 79 Grad Celsius zerstört die Kälte dort lebenswichtiges Ozon."
Kann Regen aus einer Kiste kommen?
Hans Hangartner baute sich mit seinem Vater ein Haus und zog zwei Zwillingssöhne auf, und all die Jahre über begleitete ihn sein Traum, den er niemals losließ. Erst nach 36 Jahren, im Jahre 1977, kam ihm, wie er selber sagt, "die Erleuchtung". Er erinnerte sich, wie er als Kind bei Eiscrèmeständen fasziniert zugeschaut hatte: Wie sie die Kurbel drehten, die Eiscrèmezutaten in den Metallzylinder füllten und im Holzfaß mit Eis und Salz Minustemperaturen erzeugten. Da wußte er: Die Kältephysik ist der Schlüssel. Denn wenn es oben warme Luft hat, kann es nicht regnen. Wie gut, daß er einige Zeit bei einem Ostschweizer Kühlschrankhersteller arbeitete, wo er den Kreislauf des Absorber-Kühlschranks "tiefer in sich aufnehmen" konnte!
Hangartner baute sich ein erstes Gerät und fuhr Ende August 1977 mit Frau und Schwägerin in die Ferien nach Mallorca. Im Gepäck seine Regenmaschine, im Kopf die Absicht zum ‚Laborversuch'. Der gelang dann auch gleich sehr überzeugend: Plötzlich kam aus heiterem Himmel Sturm auf, so stark, daß er die Liegestühle am Strand ins Wasser fegte - und dann regnete es! "Die Einheimischen verstanden gar nichts mehr", erinnert Hangartner sich mit einigem Vergnügen. Und seine Schwägerin schwor sich, nicht mehr mit ihm in die Ferien zu fahren. Man wollte doch endlich nur mal ein bißchen Sonne, und da machte der tatsächlich aus heiterem Himmel Regen!
Den zweiten Versuch startete er im März 1978 bei Zarziss in Südtunesien. Auch dieser war erfolgreich. Seit Herbst waren dort die Felder bestellt, doch der Regen war ausgeblieben. Ein älteres Pärchen, das seit 16 Jahren in Zarziss die Ferien verbrachte, beobachtete ihn und seine seltsame Maschine. Eines Tages sagte die Frau: "Nun weiß ich, was Sie machen - Sie sind bestimmt ein Regenmacher!" Die Wolken am Himmel, die schließlich ausregneten, sprachen für sich, und ein Rorschacher Zahnarzt, der kurz nach Hangartner nach Südtunesien reiste, bestätigte ihm, es sei ungewöhnlich kühl und regnerisch gewesen. Hangartner wußte nun, daß seine Idee funktionierte. Er war tatsächlich in der Lage, mit einfachsten Mitteln Regen zu erzeugen!