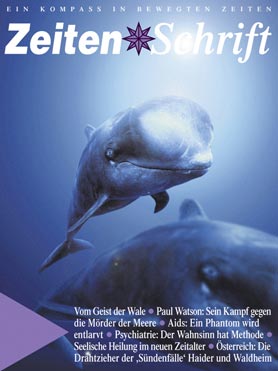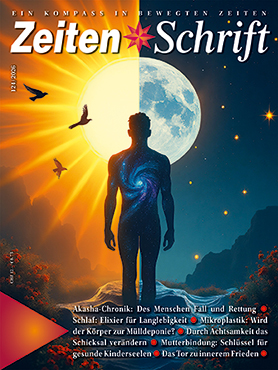Wege zur wahren Heilung
Die traditionelle Psychotherapie befindet sich in der Sackgasse. Liebe und Zuwendung, Intuition, schöpferische Meditation und die Kraft des Atems sind einige wichtige Zutaten wirklicher Heilung psychischer Probleme.
 „Geben ist seliger als Nehmen". Was jahrhundertelang nur eine religiöse Floskel schien, ist nun wissenschaftlicher härtet: Geben wirkt lebensverlängernd! In einer amerikanischen Gesundheitsstudie wurden fast dreitausend Männer und Frauen neun bis zwölf Jahre lang beobachtet. Und es zeigte sich nach wissenschaftlicher Auswertung, daß während der Nachfolgestudie beträchtlich weniger Männer starben, die über umfangreiche soziale Beziehungen und Aktivitäten verfügten. Einige soziale Aktivitäten hatten eine größere Schutzwirkung als andere. Die Forscher fanden heraus, daß Aktivitäten, bei denen regelmäßig freiwillige Arbeit geleistet wurde, zu den stärksten Faktoren einer reduzierten Sterblichkeitsrate zählten. „Bei denjenigen, die anderen mindestens einmal pro Woche freiwillig halfen, war die Wahrscheinlichkeit, während der Studie zu sterben, zweieinhalbmal geringer als bei jenen, die keinerlei freiwillige Arbeit leisteten. Anders ausgedrückt: Diejenigen, die anderen halfen, lebten selbst länger", schreibt Dr. med. Dean Ornish in seinem faszinierenden Buch Die revolutionäre Therapie: Heilen mit Liebe. Andere langjährige Studien bestätigten, daß freiwillige Dienste am Nächsten tatsächlich lebensverlängernd wirken. Die Freiwilligen fühlen sich auch oft besser und erleben manchmal eine plötzliche Ausschüttung von Endorphinen, wie wir sie vom ‘High eines Läufers' kennen.
„Geben ist seliger als Nehmen". Was jahrhundertelang nur eine religiöse Floskel schien, ist nun wissenschaftlicher härtet: Geben wirkt lebensverlängernd! In einer amerikanischen Gesundheitsstudie wurden fast dreitausend Männer und Frauen neun bis zwölf Jahre lang beobachtet. Und es zeigte sich nach wissenschaftlicher Auswertung, daß während der Nachfolgestudie beträchtlich weniger Männer starben, die über umfangreiche soziale Beziehungen und Aktivitäten verfügten. Einige soziale Aktivitäten hatten eine größere Schutzwirkung als andere. Die Forscher fanden heraus, daß Aktivitäten, bei denen regelmäßig freiwillige Arbeit geleistet wurde, zu den stärksten Faktoren einer reduzierten Sterblichkeitsrate zählten. „Bei denjenigen, die anderen mindestens einmal pro Woche freiwillig halfen, war die Wahrscheinlichkeit, während der Studie zu sterben, zweieinhalbmal geringer als bei jenen, die keinerlei freiwillige Arbeit leisteten. Anders ausgedrückt: Diejenigen, die anderen halfen, lebten selbst länger", schreibt Dr. med. Dean Ornish in seinem faszinierenden Buch Die revolutionäre Therapie: Heilen mit Liebe. Andere langjährige Studien bestätigten, daß freiwillige Dienste am Nächsten tatsächlich lebensverlängernd wirken. Die Freiwilligen fühlen sich auch oft besser und erleben manchmal eine plötzliche Ausschüttung von Endorphinen, wie wir sie vom ‘High eines Läufers' kennen.
Bei einer Studie an der Harvard Universität wurde die Hälfte der teilnehmenden Studenten gebeten, einen belanglosen Film anzusehen; die andere Hälfte sah einen Film über Mutter Teresas Arbeit an den Schwerkranken in den Slums von Kalkutta. Was geschah? Die Studenten, die den Mutter-Teresa-Film schauten, erfuhren eine beträchtliche Zunahme ihrer schützenden Antikörper. Bei den anderen war dies nicht der Fall. Es reichte also tatsächlich aus, einen Film über jemanden zu sehen, der Altruismus verkörpert, um über eine verbesserte Immunfunktion zu verfügen!
Kein Wunder, kommt Buchautor Dean Ornish zur provozierenden Schlußfolgerung: „Aus dieser Perspektive betrachtet, ist es die ‘selbstsüchtigste' Aktivität überhaupt, anderen zu helfen – und damit selbstlos zu sein -, denn dadurch können wir uns von unserer Einsamkeit und Isolation sowie von unserem Leid befreien" – und erst noch gesünder werden.
Ornish sagt, der Grund dafür, weshalb Altruismus sowohl für den Gebenden als auch für den Empfänger heilsam sei, liege darin, daß die Isolation, die uns voneinander zu trennen scheine, durch das Geben mit offenem Herzen geheilt werde. Sämtliche Religionen der Welt wissen um diese Wahrheit: „Auf einer Ebene sind wir von allen und allem getrennt (es ist dies die Ebene der Persönlichkeit, des niederen Selbst des Menschen, die Red). Sie sind Sie, und ich bin ich. Doch auf einer anderen Ebene sind wir Teil von etwas Größerem, das uns alle miteinander verbindet – das universale Selbst, das auch als Gott, Buddha, Heiliger Geist, Allah oder was auch immer bezeichnet wird."
Gemeinsam statt einsam
Diese Erkenntnisse tun not in unserer heutigen, ach so kalten Welt, in der uns die Psychologie während Jahrzehnten weiszumachen versuchte, das absolute Ideal liege im ‘unabhängigen' Menschen, in der John Wayne-Figur, die nichts und niemanden braucht. Sicher ist es wichtig und erstrebenswert, jene Form von krankhafter Abhängigkeit zu überwinden, die glaubt, nicht ohne andere leben zu können. Ansonsten aber gilt eine weitere triviale Wahrheit: Kein Mensch ist eine Insel. Tatsächlich haben denn auch viele psychische Probleme ihre Wurzel in unserer heutigen, vereinzelten, beziehungsarmen Lebensweise. Finden wir den Weg zurück zu anderen Menschen und zu unserer Verbindung mit der Natur, kann unsere Seele bereits aufatmen.
Die Vereinzelung des Menschen begann ungefähr in der Renaissancezeit in Europa. Sie hatte durchaus ihr Ziel und ihren Zweck: Für seine Weiterentwicklung war es notwendig, daß der Mensch sich seiner selbst bewußt wurde, daß er zu einer Art Super-Individualisierung ansetzte. Zuvor war er immer Teil einer Gruppe, eines Stammes, einer Zunft, eines Clans gewesen und hatte kaum Gelegenheit gehabt, wirkliche Individualität zu entwickeln. Ähnlich einem Pubertierenden, der erwachsen wird und auf eigenen Füßen stehen muß, sah sich der ehemalige Gruppenmensch aufgerufen – zumindest in Europa und im Nahen Osten – eine größere Unabhängigkeit und Eigenständigkeit zu entwickeln, um sich selbst kennenzulernen und auszudrücken, gemäß seinem ureigenen Wesen. Doch ebenso wie der Mensch so gegen Ende zwanzig meistens darangeht, eine Familie zu gründen, sich also wieder mit anderen zu vereinigen und feste Verpflichtungen einzugehen, so ist es das Ziel des nunmehr bis zur Unerträglichkeit individualisierten Menschen, die Verbrüderung mit anderen Menschen anzustreben. Die Vereinzelung mag eine kurze Episode im Menschenleben wie in der Menschheitsgeschichte sein, doch ist sie ganz bestimmt nicht das Idealbild des Homo sapiens, wie die Psychologie dies irrtümlich postulierte.
Dr. Dean Ornish belegt dies in seinem Buch eindrücklich mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien.
- Im Landkreis um die Universität Berkeley (San Francisco)beobachtete beispielsweise Lisa Berkmann 7000 Menschen neun Jahre lang. In dieser Zeit hatten Teilnehmer, denen soziale Kontakte zu Familie, Freunden oder Gruppen fehlte, das zwei- bis dreifache Risiko, vorzeitig zu sterben.
- An der Universität von Texas befragte Thomas Oxman 232 Patienten, die sich einer Operation am offenen Herzen unterzogen hatten, ob sie an Gruppenaktivitäten teilnähmen oder Trost in der Religion fänden. Wer beides verneinte, hatte in den sechs Monaten nach dem Eingriff ein Todesrisiko von 21 Prozent – siebenmal höher als diejenigen, die beides bejahten.
- Anfang der Fünfzigerjahre befragten Harvard- Forscher 126 Studenten, ob sie als Kinder ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten. 35 Jahre später litten 95 Prozent der Männer, die von keinem warmen Verhältnis berichtet hatten, unter ernsten Krankheiten: etwa Herzleiden, Bluthochdruck oder Alkoholismus. Jedoch waren nur 29 Prozent derjenigen krank, die ein gutes Verhältnis hatten.
- Für eine andere Studie gab man in den fünfziger Jahren über 2000 Männern mittleren Alters, die bei der Western Electric Company in Chicago arbeiteten, einen Fragebogen, um eine Reihe von psychologischen und emotionalen Faktoren einschließlich Depressionen einzuschätzen. Zwanzig Jahre später stellte man bei der Nachfolgestudie fest, daß beiden Teilnehmern, die bei der ersten Untersuchung unter Depressionen gelitten hatten, die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von zwanzig Jahren an Krebserkrankungen aller Art zu sterben, doppelt so hoch war.
- Ein weiterer psychologischer Faktor, der großen Einfluß auf vor zeitige Erkrankungen und vorzeitigen Tod besaß, war Feindseligkeit. Bei Menschen, bei denen in dem zwanzig Jahre zurückliegenden Test die Ergebnisse bezüglich Feindseligkeit im oberen Fünftel gelegen hatten, war das Risiko, vorzeitig zu sterben, um 42 Prozent höher im Vergleich zu jenen, bei denen die Ergebnisse in diesem Bereich im unteren Fünftel lagen.