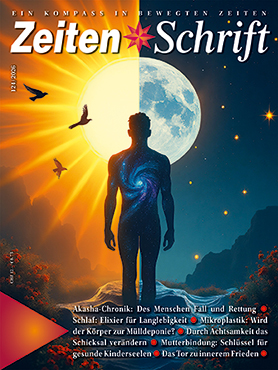Medienkonsum: Vorsicht, Informationsflut!
Noch nie war es so einfach, an Informationen über das Weltgeschehen zu gelangen. Doch unserem Gehirn ist es heutzutage oft des Guten (oder eben des Negativen) zu viel. Was also tun?
In den vergangenen Wochen jagte eine Meldung die andere. Das Virus kommt von China. Nein, die USA haben es dort absichtlich freigesetzt. Das Virus ist zwischen Menschen nicht übertragbar. Doch, das ist es, und es wird Millionen dahinraffen. Kinder übertragen das Virus eher nicht. Oder tun sie es doch? Wer Antikörper entwickelt hat, ist in Zukunft immun. Wir sind uns nicht sicher, ob der Antikörper-Nachweis aussagekräftig ist. Und so weiter und so fort.
Sich all den Hiobsbotschaften zu entziehen war so gut wie unmöglich, und man will und soll ja auch informiert sein. Doch waren und sind wir durch all diese Nachrichten besser informiert? Haben sie uns dabei geholfen, besser mit der Situation umzugehen? Vielleicht haben Sie so viele Informationen gesammelt, wie Sie nur konnten, fühlten sich dabei aber immer verwirrter und hilfloser? Oder ist irgendwann das Gegenteil passiert und Sie hatten die Nase so voll von den schlechten Berichten, dass Sie begannen, einen möglichst großen Bogen zu machen um alles, was mit Corona zu tun hat?

Wer nicht aufpasst, wird von der täglichen Informationsflut mitgerissen.
Es lohnt sich in diesem Zusammenhang, einmal genauer hinzuschauen, was die ständige (negative) Informationsflut mit uns macht. Die Flut an sich ist schon ein Problem, denn unser Gehirn kann sich jeweils nur auf eine Sache konzentrieren. Das vielgelobte Multi-Tasking beispielsweise ist in Wahrheit ein Task-Switching, also ein ständiges, schnelles Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Aufgaben. Und es ist alles andere als effizient, denn wir machen dabei mehr Fehler, brauchen länger, sind unzufriedener, erschöpfter und somit letztlich weniger produktiv, als wenn wir uns konzentriert einer Aufgabe nach der anderen widmen. Weiter sind bekannterweise „good news, no news“, oder umgekehrt, Todesfälle, Katastrophen und Verbrechen sind viel öfter eine Schlagzeile wert. Und wir neigen dazu, uns auf die negativen Nachrichten zu konzentrieren, was – so vermuten die Wissenschaftler – wohl evolutionsbiologisch bedingt ist. Für unsere Vorfahren war die Information darüber, wo der Säbelzahntiger lauerte, nämlich wichtiger, als zu erfahren, wo der nächste bequeme Lagerplatz zu finden war. Mit dem durch diese Nachricht kurzfristig ausgelösten Stress konnte der Steinzeitmensch gut umgehen, denn er musste schon unglaubliches Pech haben, um dem Säbelzahntiger täglich zu begegnen. Da dies also wohl selten der Fall war, konnte er sich dazwischen wieder beruhigen und entspannen.
Nicht so der moderne Mensch: Wir treffen fast im Sekundentakt auf den Säbelzahntiger. Selbst im Bus oder am Postschalter hängen Bildschirme, aus denen die neusten Nachrichten auf uns niederprasseln. Unser Gehirn und damit unser Körper kann nicht unterscheiden, ob es sich um eine akute, physische Bedrohung handelt oder ob diese eher abstrakter Natur ist. Studien zeigen zum Beispiel, dass es für unser Gehirn keine große Rolle spielt, ob wir uns nun von Argumenten bedroht fühlen, oder ob wir tatsächlich von einem Angreifer mit einer Waffe bedroht werden. In beiden Fällen werden dieselben Gehirnregionen aktiviert, die bei Angstgefühlen wichtig sind. Jede negative Information bedeutet für unseren Körper somit Stress, und der hat unmittelbare physische Auswirkungen. Atmung und Herzschlag werden beschleunigt, die Lungen dehnen sich, Hungergefühle werden unterdrückt und die Verdauung angeregt, die Leber setzt Glucose und damit zusätzliche Energie frei. Unser Hormonhaushalt gerät aus dem Gleichgewicht und unser Immunsystem wird geschwächt. Nebenbei haben wir auch oft noch schlechte Laune und die gesteigerte Angst kann sich mit der Zeit sogar zur Depression auswachsen. Wir sind biologisch nicht dafür geschaffen, uns ständig im Kampf- oder Fluchtmodus zu befinden. Sind wir es doch, werden wir langfristig krank.
Die Welt ist viel besser, als wir glauben
Das Paradox unserer modernen Informationsgesellschaft ist, dass wir zwar noch nie so leicht und schnell an Informationen gelangen konnten wie heute, dass die Art und Menge der Informationen unser Weltbild aber hin zum Negativen verzerrt und unsere Gesundheit beeinträchtigt. Untersuchungen zeigen, dass wir den Zustand unserer unmittelbaren Umwelt ziemlich realistisch einschätzen. Weil die Informationen, die unser Land oder sogar die Welt betreffen, jedoch meist aus zweiter oder dritter Hand stammen und für uns nicht überprüfbar sind, bewerten wir den Zustand der Welt hingegen viel negativer, als er in Wahrheit ist, wie beispielsweise der berühmte Ignoranztest der Gapminder-Stiftung zeigt.1 Dabei werden Menschen zu Themen wie Lebenserwartung, Katastrophenhäufigkeit, Kindersterblichkeit oder Bevölkerungswachstum befragt – und liegen in der Regel mit ihren Antworten weit neben der Wirklichkeit. Das Lesen von Nachrichten über ein Vorkommnis kann sogar mehr Stress auslösen, als die Realität selbst. So zeigte eine Untersuchung zum Anschlag auf den Boston-Marathon 2013, dass die Menschen, die in den Medien über den Anschlag gelesen hatten, einen höheren Stresslevel aufwiesen als Personen, die beim Anschlag tatsächlich vor Ort gewesen waren.
Der Fokus der Medien auf die Katastrophen, Bösartigkeiten und Schlechtigkeiten der Welt bewirkt bei uns aber nicht nur ein negatives Weltbild, sondern auch eine bestimmte Erwartungshaltung. Wenn wir die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einstellen, rechnen wir mit negativen Meldungen. Auch das bleibt nicht folgenlos. Unser Gehirn verändert sich (auch anatomisch) ein Leben lang aufgrund der Lernerfahrungen, die wir machen. Dabei beeinflussen sich die aktuelle Hirnaktivität und neu hinzukommende Erfahrungen unaufhörlich gegenseitig. Alles, was im Oberstübchen gerade in diesem Moment vor sich geht, wirkt sich auf den nächsten Augenblick aus, also darauf, wie man die Welt wahrnimmt und wie man neue Erfahrungen verarbeitet. Gleichzeitig bestimmt die Geschichte des Gehirns, also all das, was man im bisherigen Leben getan und wahrgenommen hat, die aktuelle Gehirnaktivität. Bezogen auf negative Nachrichtenmeldungen bedeutet dies, dass, wenn ich gelernt habe, schlechte Neuigkeiten zu erwarten und ein negatives Weltbild habe, ich genau dies in der Berichterstattung wahrnehmen werde, womit meine Erwartungen bestätigt sind und sich mein negatives Weltbild wiederum verstärkt. Die Schlange beißt sich also in den Schwanz. Nicht umsonst sagte William James, der Begründer der Psychologie: „Unser Leben ist nichts anderes als das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten.“ Sind wir in positiver Stimmung, ändert sich auch unser Verhalten. Wie Untersuchungen gezeigt haben, sind wir dann sowohl kreativer als auch sozialer. Statt nach Differenzen zu suchen, erkennen wir Ähnlichkeiten. Wir können uns besser erinnern und lösen anfallende Probleme besser. Und schließlich leben wir sogar insgesamt aktiver und gesünder.

Wir alle brauchen Ruhe und Kontemplation, um dem Getöse der Welt standzuhalten.
Wenn wir uns aber daran gewöhnt haben, dass uns schon zum Frühstück der Weltuntergang serviert wird – täglich von Neuem – stumpfen wir mit der Zeit ab, und: wir lernen, uns hilflos zu fühlen. Studien zeigen, dass ein Großteil der Nachrichtenmeldungen hilflose Menschen in ausweglosen Situationen zeigt. Diese Hilflosigkeit ist regelrecht ansteckend, die Wissenschaft kennt dafür den Begriff „erlernte Hilflosigkeit“. Wenn wir Menschen in solchen Situationen sehen, immer wieder, wächst bei uns das Gefühl der eigenen Machtlosigkeit. Beim Einzelnen kann dies Pessimismus auslösen und sogar zu Depressionen führen, doch viel weitreichender sind die Konsequenzen auf gesellschaftlicher Ebene, weil Menschen dadurch weniger hilfsbereit sind, ihre Bereitschaft, sich aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft zu beteiligen, sinkt. Anstatt zu versuchen, etwas an den Umständen zu ändern, schauen sie dann lieber im Internet süße Katzenvideos, spielen Videogames, wo sie den tapferen und starken Helden verkörpern, und verweigern im Extremfall jeglichen Medienkonsum.
Achtung Sprachfalle!
Doch Informationsverweigerung oder gar die Flucht in virtuelle Realitäten ist keine Lösung. Die Kunst besteht vielmehr darin, die vielen Informationen zu filtern, zu evaluieren und auch kritisch zu hinterfragen. Grenzwerte und Kategorien – der IQ-Wert, der Cholesterinspiegel, der ominöse R-Wert bei Corona – sind menschgemacht, es handelt sich dabei nicht um Naturgesetze. Es lohnt sich, die Aussagekraft einer Behauptung unter die Lupe zu nehmen. Was bedeutet es denn überhaupt, wenn eine Zahl gesunken oder gestiegen ist? Eine hilfreiche Gegenfrage ist oft: „Im Vergleich womit?“ Haben wir es mit Fakten zu tun, oder mit Hochrechnungen, Modellen, Schätzungen und Annahmen? Und selbst bei den messbaren Fakten können wir falsche Schlüsse ziehen. Wenn wir gleichzeitig einen Rückgang der Storchenpopulation und eine verminderte Geburtenrate bei menschlichen Babys beobachten, gibt es dann weniger Babys, weil es weniger Störche hat?
Auch der Sprache sollten wir Aufmerksamkeit schenken, denn das Wort hat Macht. Corona ist ein Paradebeispiel. Das beginnt schon beim Begriff „Coronakrise“. Die Krise taucht in den Medien immer sehr schnell auf: Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Wirtschaftskrise … da grüßt bei uns gleich jedes Mal der Säbelzahntiger.
Eine regelrechte Lüge ist der Begriff „Social Distancing“, den wir unkritisch in unseren Sprachgebrauch aufgenommen haben. Der Ausdruck suggeriert uns, dass wir sozial auf Distanz gehen sollten, uns also als Menschen und Gemeinschaft voneinander abkapseln und trennen, wo doch gerade in dieser Zeit Mitgefühl, gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit gefragt sind. Worum es eigentlich geht, wäre das physische Abstandhalten, also ein „Physical Distancing“. Oder nehmen wir das „Contact Tracing“. Da benutzen wir lieber den eleganten englischen Begriff, denn das deutsche Äquivalent „Kontakt-Verfolgung“ beschreibt viel zu deutlich, worum es sich bei der App in Wahrheit handelt. Eine besonders bedenkliche Wortschöpfung ist das „New Normal“, die neue Normalität, an die wir uns alle gewöhnen sollen. Was da so harmlos daherkommt, ist eine Monstrosität. Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand, im Notstand. Und das soll normal sein? Dies soll in Zukunft der alltägliche, nicht außergewöhnliche, übliche Zustand sein? Der Zustand, in dem wir unseren Mitmenschen als Virenschleuder betrachten (Fragen Sie einmal einen Heuschnupfen-Geplagten, wie viele böse Blicke er derzeit erntet!) und einen möglichst großen Bogen um ihn machen, noch besser, vor dem wir uns gleich maskieren, dieser Zustand also soll uns in Fleisch und Blut übergehen?
Apropos Maske: Auch hier wird die Sprache manipulativ verwendet. Eine Schutzmaske zu tragen signalisiere Respekt und Verantwortungsgefühl, heißt es. Im Umkehrschluss handelt jemand, der keine Maske aufsetzt, respekt- und verantwortungslos, auch wenn es nach wie vor höchst umstritten ist, ob das Tragen einer Maske wirklich die gewünschte Wirkung hat. Unsere Sprache macht deutlich, wie wichtig das Gesicht in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist. Viele Redensarten beziehen sich auf das menschliche Antlitz, etwa in „sein wahres Gesicht zeigen“, also seine eigentliche Gesinnung oder seinen wirklichen Charakter offen zutage treten zu lassen, anstatt ihn hinter einer Maske zu verbergen. Oder maskiert sich der Dieb etwa aus reiner Höflichkeit? Wohlverstanden, es geht hier nicht darum, den Nutzen des Tragens einer Schutzmaske infrage zu stellen, doch wenn das Tragen einer Maske dazu hochstilisiert wird, dass dies zukünftig Teil der Kultur und die Norm sei, dann sollten wir genauer hinhören. Im asiatischen Raum, der in dieser Hinsicht als Beispiel angeführt wird, dient das Tragen einer Maske mittlerweile übrigens auch dazu, sich für die unzähligen Überwachungskameras unkenntlich zu machen. Das nennt sich dann doch wohl das Pferd am Schwanz aufzäumen, oder?
Du hast die Antwort
Benutzen wir also unseren gesunden Menschenverstand. Und nutzen wir die Medien, anstatt dass wir sie bloß konsumieren, indem wir uns mit den „News“ aus aller Welt berieseln oder vielmehr bombardieren lassen. Tatsächlich ist dieses Filtern, Einordnen und Verarbeiten der vielen Informationen nicht ganz einfach. Damit uns das gelingt, brauchen wir auch immer wieder Phasen der Ruhe und inneren Einkehr. Dies ist vielleicht der positivste Effekt des weltweit behördlich verordneten Hausarrests (den wir ebenfalls lieber „Lockdown“ nennen, ein Wort, das sich auch mit „Gefängnis“ übersetzen lässt …): Viele Menschen waren gezwungen, ihr geschäftiges Leben ein paar Gänge herunterzuschrauben und stärker zur Ruhe zu kommen. Wir alle werden mit einem inneren Kompass geboren, jeder Mensch kann intuitiv zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und wie wir Dinge beurteilen und einordnen, hängt stark von unserer moralischen „Inneneinrichtung“ ab, oder anders formuliert, von unserem Gewissen. Dieses brüllt aber nur selten wie ein wütender Löwe, meistens ist seine Stimme ruhig und fein. Und im Getöse des Alltags, im Lärm unserer Gedanken und dem Strudel unserer Gefühle kann diese zarte Stimme auch untergehen. Hier hilft nur die innere Einkehr und dass wir lernen, dieser Stimme, wenn wir sie denn endlich (wieder) hören, auch zu vertrauen. Es wäre schön, wenn wir dies als positive Lehre rund um Corona mitnehmen könnten: zur Ruhe zu kommen, und die Antworten in uns, statt außerhalb zu suchen.
Diesen Artikel können Sie übrigens hier kostenlos als PDF herunterladen.
Lesen Sie unbedingt auch die folgenden spannenden ZeitenSchrift-Artikel zum Thema Coronavirus, Angst und Emotionen:
- Coronavirus:
- Die Angst ist manchmal schlimmer als das Virus...
- Coronavirus: Eine Barriere der Angst
- Gedanken sind Magie
- Die Tyrannei der Emotionen...
- Gedanken: Der Stoff aus dem die Welt geboren ist
- Mach ihnen Angst, und sie rufen nach Bewachern!
- Mach mal Pause...
- Gehirn-Special: Sich in den Geist des Universums einklinken
Quellenangaben
- 1 vgl. www.gapminder.org
Veröffentlicht in den Kategorien Gesundheit • Wissenschaft, Politik • Gesellschaft