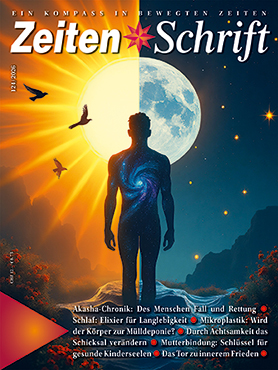Mach mal Pause...
Nein, es geht nicht um die Milchschnitte und erst recht nicht um die Zigarettenpause. Hier dreht sich alles um die aktive Ruhepause, die im Gleichgewicht mit der Arbeit unser Leben einfacher, aber reicher macht und uns vor dem Ausbrennen bewahren kann.

Grundrecht Siesta: Früher nahm man sich nicht bloß in südlichen Gefilden noch Zeit auszuruhen.
Wie wäre der Zweite Weltkrieg wohl ausgegangen, hätte Dwight D. Eisenhower, der spätere 34. Präsident der USA, ein Burnout erlitten? Der Job, den er ab Juni 1942 zu erfüllen hatte, war zweifellos anspruchsvoll genug, um mit jeglichem Managerposten, der heute den einen oder andern in die Knie zwingt, verglichen zu werden. Als Eisenhower seine Aufgabe als Oberkommandierender des amerikanischen Hauptquartiers in Europa in Angriff nahm, tobte auf dem europäischen Kontinent schon fast zwei Jahre lang der Krieg. Der amerikanische Führungsstab war überaltert und musste neu geformt werden; es galt, den Einmarsch in Nordafrika vorzubereiten, die Zusammenarbeit mit den britischen Truppen zu organisieren und so weiter und so fort. Gemäß seinem Adjutanten Harry Butcher saß Eisenhower täglich fünfzehn bis achtzehn Stunden an der Arbeit, und die vielen Probleme raubten ihm oft die verbleibenden wenigen Stunden Schlaf. Was tat Eisenhower? Er gab Butcher den Auftrag, sich um einen „Unterschlupf” zu kümmern. Butcher wurde fündig mit „Telegraph Cottage”, einem einfachen englischen Landhaus, umgeben von vierzig Hektar Wald und Wiese. Dorthin zog sich Eisenhower so oft wie möglich zurück, spielte Golf oder Bridge, las Cowboygeschichten oder machte Ausritte.
Wie bitte, der Oberkommandierende der Amerikaner las Cowboyromane, während rund um ihn Europa in Schutt und Asche fiel? Bestimmt nutzte er aber seine Golfpartien, um mit anderen Entscheidungsträgern in entspannter Umgebung die aktuelle Lage zu besprechen, oder hielt zu diesem Zweck abendliche Dinner ab? Nein, tat er nicht. Nur sehr wenige Menschen außerhalb seines Stabs wussten, wo sich Eisenhower jeweils befand. Was uns heute als ungeheuerliche Verantwortungslosigkeit erscheinen mag, war tatsächlich, was Eisenhower „vor dem Nervenzusammenbruch” bewahrte, wie seine damalige Fahrerin Kay Summersby später erzählte. Es war das völlig andere Leben in Telegraph Cottage, das Eisenhower dabei half, leistungsfähig zu bleiben.
Ausruhen oder abhängen?
Dass wir es schon fast als verwerflich empfinden, wenn sich jemand in einer Position von hoher Verantwortung oder grundsätzlich in Zeiten mit starkem Arbeitsdruck erlauben sollte, sich mit scheinbar Banalem oder Trivialem abzugeben und sich überhaupt solch ausgiebige Pausen gestattet, zeigt, welch zwiespältiges Verhältnis wir mittlerweile gegenüber dem Ausruhen haben. Nicht, dass das Ausruhen oder die Pause kein Thema wäre; es gibt Ratgeber und Seminare zuhauf. Ebenso zahlreich sind die Ansichten darüber: Für die einen sind Pausen vor allem Müßiggang, sie bemühen sich, „smarter” zu arbeiten, um mehr zu erreichen. Andere halten Kreativität und Arbeit schlicht für unvereinbar; wer kreativ ist, kann nicht auch noch arbeiten. Wieder andere sehen Muße als Luxusgut, von dem sich diejenigen, die es sich leisten können, möglichst viel unter den Nagel reißen, es genießen und den anderen zeigen, wie gut es ihnen dabei geht. Doch Arbeit und Ruhepausen sind keine Gegensätze, sie sind nicht Widersacher, sondern Partner. Pausen helfen uns, besser und leistungsfähiger zu arbeiten, sie sind der Motor für unsere Kreativität und Produktivität.
Der Haken dabei: Auch richtiges Pausieren will gelernt sein. Abhängen vor dem Fernseher, Feiern bis zum Umfallen am Wochenende, Ramba-Zamba auf Mallorca in den Ferien, zielloses Surfen im Internet bei der Arbeit und in der Freizeit – das ist nicht die Art von Pause, die uns wirklich Erholung schenkt und mit neuem Elan unsere Arbeit anpacken lässt. Die Pausen, um die es hier geht, sind aktiv und erfüllt, und wiederum begegnen wir zwei Stichworten, die im Zusammenhang mit dem „guten” und „gesunden” Leben immer wieder auftauchen, nämlich Balance und Rhythmus. Weder ist die Idee, der Arbeit aus dem Weg zu gehen, damit noch Raum für Pausen bleibt, noch umgekehrt das Ausruhen so genüsslich zu zelebrieren, dass die Arbeit zum Beigemüse auf dem Lebensteller wird. Das Ausruhen, über das wir hier schreiben, hält sich die Waage mit der Arbeit (die durchaus auch als Lebenswerk verstanden werden kann, nicht nur als Tagwerk) und wirkt befruchtend und inspirierend auf diese. Damit das Pausieren nicht ausufert, hilft es, sich einen Rhythmus zuzulegen; so entsteht Struktur und die Pause kann beansprucht werden … denn ganz von alleine kommt sie nicht.
Besser brüten
Um die Kunst der Pause zu verstehen, muss man sich zweierlei Dingen bewusst sein. Bis in die 1990er-Jahre glaubte man, beim Schlafen geschähe im Gehirn einfach nichts, auch bei Tagträumen und ähnlich „unproduktiven” Tätigkeiten ging man davon aus, dass das Gehirn inaktiv sei. Dann wurde entdeckt, dass unser Gehirn in solchen Fällen auf das sogenannte „Default Mode Network” (DMN), das Ruhezustandsnetzwerk, umschaltet. In diesem Modus sind bestimmte Hirnregionen besonders stark vernetzt und aktiver als andere Bereiche. Das ruhende Gehirn ist dabei nur geringfügig weniger tätig, als wenn wir uns mit einer konkreten Problemstellung befassen, quasi Hirnjogging betreiben, und es braucht auch fast ebenso viel Energie. Der Ruhemodus unseres Gehirns hat Anteil an praktisch allen kognitiven und emotionalen Vorgängen wie Intelligenz, moralisches Urteilsvermögen, Einfühlungsvermögen und psychische Gesundheit. Unser Gehirn arbeitet also eigentlich immerzu, doch liegt es in unserer Hand, ihm die Art von Ruhe zu gönnen, die seiner Gesundheit, Entwicklung und Produktivität zuträglich sind.
Der zweite Punkt ist, dass Wissen und kreative Einfälle heutzutage oft als Produkt betrachtet werden, also etwas, das produziert und nicht etwa entdeckt oder freigelegt wird. Exemplarisch zeigt sich das am modernen Großraumbüro. Dieser Arbeitsraumgestaltung liegt unter anderem die Auffassung zugrunde, dass geistige Höhenflüge und kreative Ideen nicht durch Nachdenken und Kontemplation zustande kommen, sondern durch Brainstorming, Zufallsbegegnungen und das Aufeinanderprallen von Menschen und Meinungen.
Der englische Psychologe Graham Wallas kam zu einem anderen Ergebnis.1 Er hatte versucht herauszufinden, ob bei schöpferischen Durchbrüchen und Geistesblitzen irgendein Muster zu erkennen war, und dem ist tatsächlich so. Geistesblitze durchlaufen offenbar vier Phasen der Entstehung. Am Anfang steht die Vorbereitung. Hier wird sichtbar gearbeitet, recherchiert, studiert, skizziert und nachgedacht. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man nicht weiterkommt, man steht gewissermaßen vor einer geistigen Mauer. Dies ist der Augenblick, wo Phase zwei eingeleitet werden muss: die Inkubation oder Bebrütung. Löst man ein Kreuzworträtsel, dauert die Inkubationszeit vielleicht nur wenige Sekunden. Bei anspruchsvollen Problemen kann sie sich über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre hinziehen. Gemäß Wallas darf in dieser Phase nichts „das freie Wirken der unbewussten oder teilbewussten Prozesse stören”. Es muss daher sehr viel echte geistige Entspannung stattfinden.2 Selbst in dem Moment, wenn die Lösung zum Greifen nah scheint, soll man sich noch nicht wieder aktiv dem Problem zuwenden, das könnte das „Ausbrüten” stören oder unterbrechen. Die dritte Phase – die Illumination respektive Erleuchtung – kommt ganz von allein. Dies ist der berühmte Aha-Effekt, er passiert urplötzlich und ohne Anstrengung. Nun kann man sich dem Problem wieder mit aller Kraft und Aufmerksamkeit widmen. In der vierten und letzten Phase, der Verifikation oder Überprüfung, arbeitet man wie in der Vorbereitungsphase bewusst und formgebunden. Hier werden Techniken angewandt, Einzelheiten ausgearbeitet und das ganze Vorhaben zum Abschluss gebracht. Die richtigen Ruhepausen, mit denen wir uns in diesem Artikel beschäftigen, können uns bei Schritt zwei und drei – Inkubation und Illumination – wertvolle Dienste leisten.
Quellenangaben
- 1 Zwar stammt sein Buch The Art of Thought aus dem Jahr 1926, doch auch das Rad wurde im 4. Jahrtausend vor Christus erfunden und dreht sich immer noch … Die Erkenntnisse von Graham Wallace wurden übrigens von der modernen Wissenschaft schon mehrfach bestätigt.
- 2 Wir sehen später, wie diese konkret aussehen kann.