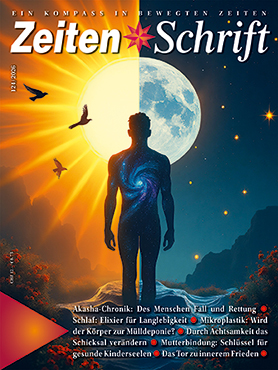Der infame Erste Weltkrieg
In diesen Tagen vor Hundert Jahren (Juli 1914) brach der Erste Weltkrieg aus. Frohgemut zogen die Soldaten in einen "kurzen" Krieg, um dann zu Millionen in den Schützengräbern dahingemetzelt zu werden. Der Erste Weltkrieg war jedoch mehr als die größte und opferreichste Schlacht, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Folgen Sie uns in unserem Report auf der Spurensuche nach den wirklichen Ursachen und Gründen für den Ersten Weltkrieg; lesen Sie, wer am meisten von ihm profitiert und wer am meisten durch ihn verloren hat.
Der Erste Weltkrieg begann als kleines Geplänkel und endete als die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts. „Weihnachten sind wir wieder zu Hause“, riefen die Soldaten, die in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 die Züge zur Front bestiegen. Am Ende hatte der „Große Krieg“ vier Jahre, drei Monate und elf Tage gedauert und in jeder seiner Minuten vier Soldaten den Tod gebracht – insgesamt zehn Millionen. Er hatte einen aufstrebenden Kontinent in Schutt und Asche gelegt und vor Leben sprühende Nationen in Armut und Verheerung gestürzt. Er hatte mehr seelische und physische Krüppel hinterlassen als jeder Krieg vor ihm und den Menschen das Urvertrauen ins Leben und an die bestehende Ordnung geraubt. – Und über alledem schwelte beständig die Frage: Wozu das alles?
Schaut man in die gängigen Geschichtsbücher, bleibt die Frage unbeantwortet. Nicht nur Stefan Zweig kam zu dem Schluss: „Wenn man heute ruhig überlegend sich fragt, warum Europa 1914 in den Krieg ging, findet man keinen einzigen Grund vernünftiger Art und nicht einmal einen Anlass. Es ging um keine Ideen, es ging kaum um die kleinen Grenzbezirke; ich weiß es nicht anders zu erklären als mit diesem Überschuss an Kraft, als tragische Folge jenes inneren Dynamismus, der sich in diesen vierzig Jahren Frieden angehäuft hatte und sich gewaltsam entladen wollte. Jeder Staat hatte plötzlich das Gefühl, stark zu sein, und vergaß, dass der andere genauso empfand, jeder wollte noch mehr und jeder etwas von dem anderen.“ Hier irrt Zweig; es mag sich atmosphärisch so angefühlt haben. Aus der Distanz ist es heute jedoch unbestritten, dass das mit ungeheurer Kraft aufstrebende Deutsche Reich, das es erst seit den Tagen Bismarcks – eben jenen gut vierzig friedvollen Jahren – gab, England zunehmend ein Dorn im Auge war. Aus dem Jahr 1910 ist ein Gespräch überliefert, das Lord Balfour, Parteichef der englischen Konservativen, mit dem US-Botschafter in London, Henry White, führte.1 Balfour: „Wir sind wahrscheinlich töricht, dass wir keinen Grund finden, um Deutschland den Krieg zu erklären, ehe es zu viele Schiffe baut und uns unseren Handel wegnimmt.“
White: „Sie sind im privaten Leben ein hochherziger Mann. Wie ist es möglich, dass Sie politisch etwas so Unmoralisches erwägen können, wie einen Krieg gegen eine harmlose Nation zu provozieren, die ein ebenso gutes Recht auf eine Flotte hat wie Sie? Wenn Sie mit dem deutschen Handel konkurrieren wollen, so arbeiten Sie härter.“
Balfour: „Das würde bedeuten, dass wir unseren Lebensstandard senken müssten. Vielleicht wäre ein Krieg einfacher für uns.“
White: „Ich bin erschrocken, dass gerade Sie solche Grundsätze aufstellen können.“
Balfour: „Ist das eine Frage von Recht und Unrecht? Vielleicht ist es nur eine Frage der Erhaltung unserer Vorherrschaft.“
Dass Deutschland dem britischen Weltreich, in dem seit ein paar Jahrhunderten die Sonne nicht mehr unterging, Sorgen bereitete, überrascht nicht, wenn man seinen schwindelerregenden Aufstieg von der „Ansammlung unbedeutender Staaten, regiert von unbedeutenden Prinzchen“ (Lord Welby) zum mächtigsten Staat Europas betrachtet. „Bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges“, diagnostiziert der britische Historiker Paul Kennedy, „war Deutschlands nationale Macht nicht nur drei- bis viermal so groß wie die Italiens oder Japans, sondern es besaß auch einen großen Vorsprung vor Frankreich oder Russland und hatte wahrscheinlich sogar Großbritannien überholt.“
Ein Befund, den die Statistiken bestätigen. „1913 produzierte das Deutsche Reich mehr Stahl als Großbritannien, Russland und Frankreich zusammengenommen – ein Indikator militärischer Kapazität“, bemerkt Bruno Bandulet in seinem Buch Als Deutschland Großmacht war. Er fügt an: „Besonders aussagekräftig ist auch der Anteil an der Weltindustrieproduktion. Im Zeitraum 1880 bis 1913 erhöhte sich der Anteil Deutschlands von 8,4 auf 14,8 Prozent (und wurde nur vom amerikanischen übertroffen), während der britische Anteil an der weltweiten Industrieproduktion von 22,9 auf 13,6 Prozent zurückging.“
Auch in punkto Bildung hatten sich die Deutschen zu Musterschülern entwickelt: Die Zahl der Analphabeten, welche unter den Rekruten in die Armee eintraten, gibt ein gutes Bild davon ab. In Italien waren damals 330 von tausend Soldaten des Lesens nicht mächtig; in Österreich-Ungarn 220 von tausend, in Frankreich 68 und in Deutschland einer von tausend! Der hohe Bildungsstand zeigte sich auch in der Industrie: In der deutschen Industrie waren um 1900 rund 500 Chemiker in der Forschung beschäftigt, in der britischen nur 30 bis 40.2
Trotz seiner Wirtschaftskraft, trotz des Flottenbaus (der zur Ausdehnung des Handels und für die abschreckende Wirkung im Falle eines Kriegs betrieben wurde) gebärdete sich das Deutsche Reich in keiner Weise als Aggressor. Kaiser Wilhelm II. war anglophil bis zur Peinlichkeit, bezüglich seiner Kolonien hatte Deutschland sich mit wenigen Ländern zufriedengeben und seinen Bürgern gewährte es mehr Rechte und Freiheiten als England, gab es im Kaiserreich doch von Anfang an das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht, zu dem sich England erst 1918 durchringen konnte.
Bleibt also immer noch die Frage: Wozu dieser schrecklichste aller bis dahin gekannten Kriege?
Die Antwort liegt vielleicht darin, dass der schon erwähnte Lord Balfour in den Diensten der Rothschilds stand. So abgedroschen es klingen mag: Die wahren Gründe für den „Großen Krieg“ findet man nur, wenn man nachforscht, wem er nützte, wer also durch ihn reicher und mächtiger wurde, während Europas Männer auf den Schlachtfeldern verbluteten, erblindeten oder verblödeten.
Die Monarchen waren es nicht. Vier Monarchien waren – neben den Republiken Frankreich und Italien – als große Kriegsparteien gegeneinander angetreten; den Krieg überlebt hat nur eine, nämlich die britische. Die Kaiser von Deutschland und Österreich mussten abdanken, ihre Reiche wurden zerpflückt, der Zar mit seiner ganzen Familie ermordet. Russland stolperte in die Nacht von siebzig Jahren kommunistischer Gewaltherrschaft, Deutschland wurde in Versailles schuldig gesprochen und mit einer Strafe belegt, welche es für Jahrzehnte zum Sklavenstaat machen sollte und welche die Zündschnur für einen neuerlichen Krieg legte – und Österreich-Ungarn schrumpfte nach siebenhundert Jahren als Großmacht zum politisch unbedeutenden Kleinstaat zusammen.
Ein sonniger Sonntag im Juni
Dabei hatte alles mit Österreich begonnen – zumindest äußerlich. Mit jenem berüchtigten Attentat auf den Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 zu Sarajewo. Nimmt man diesen Tag unter die Lupe, scheint es fast, als hätte das Schicksal mit aller Macht verhindern wollen, dass das Schreckliche geschah – und hätte ausgerechnet die unbeliebt gewordene Tugend des Anstands, von welcher der Thronfolger nicht lassen wollte, schließlich den Weg zum Verhängnis geebnet.
Als Erzherzog Franz Ferdinand an jenem Sonntagmorgen mit seiner Gemahlin Sophie Chotek sein Automobil bestieg,3 schien, nachdem es am Samstag geregnet hatte, die Sonne und so fuhr man mit offenem Verdeck. Und obwohl serbische Terroristen seit 1909 bereits vier Attentate auf hohe österreichische Sicherheitsbeamte ausgeführt und weitere geplant hatten, wurde am 28. Juni auf die einfachsten Sicherheitsvorkehrungen verzichtet.4 Weder hatte das Militär ein Kordon gebildet, noch wurde genügend Polizei entlang der Fahrtroute postiert. Die Leibwache des Erzherzogs war aus Versehen am Bahnhof zurückgelassen worden. Franz Ferdinand, ein Fatalist nach langer, schwerer Krankheit, hatte sich bei einer früheren Gelegenheit so geäußert: „In Lebensgefahr sind wir immer. Man muss nur auf Gott vertrauen.“
„Auf den Beistand von oben war dieses eine Mal kein Verlass“, bemerkt Buchautor Bandulet. „Entlang des Kais warteten sieben Terroristen, die in den Tagen zuvor in die Stadt eingesickert waren. Ausgerüstet mit Bomben, geladenen Pistolen und einer Tüte Zyanid für den anschließenden Selbstmord.
Der zweite Attentäter, den die Kolonne passierte, ein aus Bosnien stammender Serbe namens Nedeljko Cabrinovi, handelte. Er warf seine Bombe, der Fahrer Franz Ferdinands gab Gas, und bis heute ist nicht klar, ob der Erzherzog den Sprengsatz mit der Hand wegschlug oder ob er vom zurückgeschlagenen Verdeck ab-prallte. Er explodierte unter dem folgenden Fahrzeug. Einer der Insassen, der Oberst Erik von Merizzi, wurde schwer verletzt – und eben diese Verletzung sollte der Grund dafür sein, dass der zweite Mordanschlag dann doch gelang.
Alle Sicherheitsregeln, die heutzutage bei Staatsbesuchen Routine sind, wurden missachtet. Anstatt den Appelkai schnellstens zu verlassen, ließ Franz Ferdinand anhalten, stieg aus und kümmerte sich um die Verwundeten. Eine weitere Gelegenheit für die anderen Attentäter zuzuschlagen. Wie durch ein Wunder passierte nichts. Die noch sehr jungen Serben und der eine muslimische Bosnier, der ebenfalls zur Gruppe gehörte, reagierten nicht kaltblütig genug. Sie zögerten.
Der Erzherzog und sein Gefolge setzten die Fahrt fort und erreichten das Rathaus, wo die üblichen Reden gehalten wurden und wo Franz Ferdinand ein Telegramm an den Kaiser Franz Joseph verfasste, um ihm zu versichern, dass sie beide wohlauf seien. Dann aber traf der Thronfolger die Entscheidung, die ihn das Leben kosten sollte. Er lehnte den Vorschlag des Gouverneurs ab, entweder zu dessen Residenz zu fahren oder Sarajewo zu verlassen, und bestand darauf, den verwundeten Oberst von Merizzi im Krankenhaus zu besuchen.
Damit die Attentäter, von denen noch sechs auf freiem Fuß waren, eine zweite Chance bekamen, musste ein weiterer Zufall ins Spiel kommen. Der Fahrer bog auf der Höhe des Basarviertels falsch ab und kuppelte aus, um zurückzufahren. Genau dort in der Franz-Joseph-Straße, wo der Wagen fast zum Stillstand kam, stand Gavrilo Princip, zog seine Pistole und schoss zwei Mal. Die erste Kugel durchschlug die Autotür und durchtrennte die Bauchschlagader der Herzogin. Die zweite traf den Erzherzog und zerfetzte seine Halsvene. Franz Ferdinand konnte noch flüstern: ‚Sopherl, Sopherl, sterbe nicht, bleibe am Leben für unsere Kinder.’ Um elf Uhr waren beide tot.“
Was danach geschah, ist rasch erzählt – der deutsche Kaiser Wilhelm II. stand zu seinem Versprechen, Österreich im Kriegsfalle beizustehen. Auf einem seiner Dokumente hatte er nach dem Attentat von Sarajewo notiert: „Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald.“ Der Kaiser, der dem ermordeten Erzherzog und seiner Frau sehr nahegestanden hatte, sah in dem „Prinzenmord“, wie er sich ausdrückte, einen unerträglichen Angriff auf das moralische Prinzip als solches. Wilhelm wollte dem „serbischen Schurkenstaat“ zusammen mit Österreich einen kurzen, klaren Denkzettel verpassen – und dies so schnell wie möglich nach dem Attentat. Er dachte, dass ein Militärschlag gegen Serbien von den anderen europäischen Regierungen eher geduldet würde, solange der Schock über das Attentat noch frisch war. Allein, die K.-u.-k.-Monarchie Österreichs funktionierte nicht im Ruck-Zuck-Zack-Zack-Tempo der Deutschen – und zudem wurden die Männer im Juli noch beim Einbringen der Ernte gebraucht. So verstrich ein ganzer Monat, während welchem eine sogenannt „fieberhafte Diplomatie“ hinter den Kulissen gepflegt wurde, die nicht zum Ziel hatte, den Frieden zu bewahren, sondern aus einem lokalen Scharmützel einen europaweiten Krieg zu machen.
Denn in Wahrheit war der Krieg gegen Deutschland seit Jahren beschlossene Sache. Der Erste Britische Seelord, John A. Fisher, bemerkte schon 1912: „Der Große Krieg wird jetzt vorbereitet, ohne dass es jemand sieht.“ Und der New Yorker Erzbischof Kardinal John Murphy Farley äußerte wenige Monate vor dem Attentat von Sarajewo, was die Öffentlichkeit nicht ahnte und was auch die meisten Historiker bis heute nicht erkannt haben (oder erkennen wollen): Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als große Bankgeschäfte regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden.
Quellenangaben
- 1 aus: Bruno Bandulet, Als Deutschland Grossmacht war
- 2 ebd.
- 3 Lesen Sie mehr zu diesem Unglücksauto in der ZeitenSchrift 79: Vom geheimen Leben der Dinge
- 4 Schilderung des Attentat-Tages aus Bruno Bandulets Buch Als Deutschland Grossmacht war