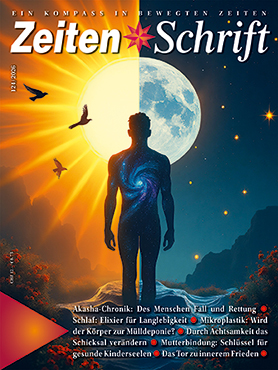Placebo-Effekt: Selbstheilung gefällig?
Eine Ärztin und Wissenschaftlerin beweist: Es gibt keine unheilbaren Krankheiten! Das Phänomen der Spontanheilung tritt wesentlich häufiger auf, als allgemein bekannt ist. Werfen Sie einen Blick auf ein revolutionäres neues Gesundheitsverständnis, das uns auch den Weg in eine pandemiefreie Welt weist.

Dr. Lissa Rankin hatte es in ihrem Klinikalltag als Schulmedizinerin immer wieder mit Patienten zu tun, die gesund wurden, obwohl dies aus rein fachlicher Sicht gar nicht möglich sein konnte. Auch von Arztkollegen bekam sie bisweilen Geschichten zu hören, die den Rahmen des Vorstellbaren sprengten. „Da wird hinter vorgehaltener Hand über den Fall einer Frau gesprochen, deren bösartiger Tumor während der Bestrahlungen verschwunden ist. Und später merken die Ärzte, dass das Bestrahlungsgerät defekt war und sie nicht ein Fitzelchen Strahlung abbekommen hat. Sie hatte es nur geglaubt! Und ihre Ärzte ebenfalls“, berichtet Dr. Rankin. Einem Mann mit blockierten Herzkranzgefäßen teilte man nach einem Herzinfarkt mit, dass er ohne Operation innerhalb eines Jahres sterben würde. Doch er weigerte sich, sich dem Eingriff zu unterziehen, lebte weitere zwanzig Jahre und starb schließlich im Alter von 92 Jahren (und zwar nicht an den Folgen einer Herzkrankheit). Auch die Geschichte von Anita Moorjani1 kam Dr. Rankin zu Gehör: Die Inderin lag auf der Intensivstation mit Krebs im Endstadium, da ihre Organe eins nach dem anderen versagten. Im Koma liegend hatte sie ein Nahtoderlebnis, bei dem ihr klar wurde, dass ihr Krebs beinahe augenblicklich verschwinden würde, wenn sie sich entschloss, zurück ins Leben zu kehren und frei zu sein von aller Angst. Weniger als einen Monat später konnten in ihrem Körper keinerlei Krebszellen mehr nachgewiesen werden. Dr. Rankin musste also feststellen, dass es Patienten gab, die von „unheilbaren“ Krankheiten genasen, sodass jene, welche die „tödliche“ Diagnose gestellt hatten, plötzlich wie Idioten dastanden. Und so meldete sich bei ihr eine nagende Stimme zu Wort. Für all diese Fälle musste es doch irgendeine Erklärung geben! Eine Erklärung, die jenseits dessen liegen musste, was sie in ihrer schulmedizinischen Ausbildung gelernt hatte. Das war der Beginn von Dr. Rankins Suche nach wissenschaftlichen Beweisen für das Wirken der Selbstheilungskräfte im Menschen. Die Erkenntnisse, die sie dabei gewonnen hat, haben ihre Auffassung von Medizin – wie sie praktiziert werden soll und welche Rolle dem Patienten darin zukommt – von Grund auf verändert.
„In jedem von uns ist ein Funke, man mag ihn göttlichen Funken nennen, doch wie auch immer, er ist da und kann den Weg zur Genesung erhellen. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten, nur unheilbare Menschen.“
Dr. med. Bernie S. Siegel
Wodurch wirkt der Placebo-Effekt?
Zu Beginn ihrer Forschungsreise interessierte Lissa Rankin insbesondere, ob allein die Erwartung, der Körper würde medikamentös oder chirurgisch behandelt, eine reale, konkret spürbare Linderung von Symptomen bewirken kann – Stichwort: Placebo-Effekt. Gleich mehrfach wurde sie fündig: Bei annähernd der Hälfte der Asthmatiker lässt sich mit einem wirkstofffreien Inhalator oder einer Scheinakupunktur eine Verbesserung der Beschwerden erreichen. Etwa 40 Prozent der Kopfschmerzpatienten sprechen positiv auf ein Placebo an. Bis zu 40 Prozent der wegen Unfruchtbarkeit behandelten Patientinnen werden nach der Einnahme von Placebo-„ Fruchtbarkeitsmedikamenten“ schwanger. In der Schmerzbehandlung sind Placebos tatsächlich annähernd so wirksam wie Morphium. Und zahlreiche Studien beweisen, dass die glücklich machenden Wirkungen von Antidepressiva fast ausnahmslos dem Placebo-Effekt zugeschrieben werden können.
Sogar chirurgische Scheininterventionen können äußerst effektiv sein: In einem Experiment in Houston, Texas, wurden 120 Patienten mit Knie-Arthrose operiert, 60 erhielten oberflächliche Schnitte auf der Haut. Nach zwei Jahren waren 90 Prozent der Patienten beider Gruppen mit der Operation zufrieden. Einziger Unterschied war, dass die Nicht-Operierten weniger Schmerzen verspürten als die Kontrollgruppe.
Rankin fand auch Untersuchungen, die sich mit der Frage befassen, ob bestimmte Typen von Patienten empfänglicher für Placebo-Reaktionen sind als andere. Bei einer solchen Untersuchung gingen die Forscher davon aus, dass sie bei Probanden, die positiv auf Placebos ansprachen, einen geringeren IQ oder eine „neurotische“ Veranlagung feststellen würden. Doch sie fanden heraus, dass bei entsprechenden Grundvoraussetzungen so gut wie jeder Mensch dazu gebracht werden kann, auf Placebos zu reagieren. Jeder ist empfänglich, selbst Ärzte und Wissenschaftler. Es gibt sogar Studien, die darauf hinweisen, dass Menschen mit höherem IQ stärker auf Scheinmedikamente reagieren. Für Dr. Rankin war das eine gute Nachricht. „Wenn es nämlich stimmt, dass allein eine positive Erwartungshaltung den Körper heilen kann, haben wir alle die gleiche Chance, von diesem Phänomen zu profitieren.“ Es seien also nicht nur vertrauensselige Schlichtgemüter, die sich gesund glauben können, sondern auch Schlaumeiern könne dies gelingen, meint Rankin.

„Wir Ärzte tun nichts. Wir unterstützen und ermutigen nur den Arzt im Inneren des Menschen.“ – Dr. Albert Schweitzer (1875–1965)
Doch bedeutet dies nun, dass sich die Linderung von Symptomen ausschließlich im Kopf abspielt? Auch der Frage, ob wir uns das Ganze also einfach nur einbilden und uns deshalb besser fühlen, ging die Ärztin nach. „Wenn es wirklich stimmt, dass der Geist den Körper heilt, muss sich der Nachweis erbringen lassen, dass der Körper anspricht – und zwar nicht nur mit einer Linderung von Symptomen, sondern auf physiologisch messbare Weise.“ Auch solche Beweise fand Rankin: Nach der Gabe von Placebos wachsen kahlköpfigen Männern Haare, der Blutdruck sinkt, Warzen verschwinden, Geschwüre heilen aus, überschüssige Magensäure wird reduziert, Darmentzündungen werden gelindert, nach zahnmedizinischen Eingriffen entspannt sich die Kiefermuskulatur und Schwellungen gehen zurück, bei Parkinson-Patienten steigen die Dopaminwerte im Gehirn und bei Schmerzpatienten kommt es nach einer Symptomlinderung zu einer Aufhellung der entsprechenden Gehirnareale, wie sich mit bildgebenden Verfahren nachweisen lässt.
Lissa Rankin nennt mehrere mögliche Erklärungen für den Placebo-Effekt. Die offensichtlichste ist, dass es zu subjektiven Symptomverbesserungen und physiologischen Veränderungen kommt, weil der Patient überzeugt ist, dass dies passieren wird. Mit anderen Worten: die Erwartung, dass man sich anders fühlen wird, führt dazu, dass man sich tatsächlich anders fühlt. Eine andere Erklärung liegt in der klassischen Konditionierung. Erinnern wir uns an Pawlows berühmten Versuch mit dem Hund: Dieser reagierte nicht nur mit vermehrtem Speichelfluss, wenn er Futter bekam; der Sabber begann bei ihm schon zu laufen, wenn er nur das Glöckchen hörte, das bei jeder Fütterung ertönte. Der Placebo-Effekt könnte auf ähnliche Weise funktionieren: Wer es gewohnt ist, von einer Person im weißen Kittel echte Medikamente verabreicht zu bekommen, ist womöglich darauf konditioniert, sich auch dann besser zu fühlen, wenn ihm ein ebensolcher Weißkittel eine bloße Zuckerpille reicht. Eine weitere wichtige Erklärung für die positive Wirkung von Scheinbehandlungen läuft darauf hinaus, dass Patienten, die an einer klinischen Studie teilnehmen, in den Genuss von emotionaler Zuwendung kommen. So vertritt der Harvard-Professor Ted Kaptchuk, der den Placebo-Effekt erforscht hat, in seinen Fachartikeln und Interviews oft die These, dass die fürsorgliche Zuwendung durch eine anerkannte Autoritätsfigur gleich stark, wenn nicht noch stärker, am Placebo-Effekt beteiligt ist wie die positive Erwartungshaltung. In einem Interview dazu sagte er: „Eine Zuckerpille allein bewirkt gar nichts. Was wirkt, ist der therapeutische Kontext. Es sind die Rituale des Heilens. Die Tatsache, dass eine heilende Beziehung entsteht.“ Dass auch das Verhalten des Arztes am Krankenbett oder seine innere Einstellung dem Patienten gegenüber einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf hat, fand die Ärztin Rankin ebenfalls bestätigt. So wurden im New England Journal of Medicine die Ergebnisse einer randomisierten Studie an Patienten publiziert, die kurz vor einer Operation standen. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen saßen in ihrem Aufklärungsgespräch einem gut gelaunten, optimistischen Anästhesisten gegenüber, der ihnen versicherte, dass die anstehende Operation ein Kinderspiel sei, sie bequem gelagert und keinerlei Schmerzen haben würden und alles rundum glatt ablaufen würde. Die anderen hatten Pech. Sie wurden von Anästhesisten betreut, die man anwies, sich von ihrer gereizten, gehetzten und unsympathischen Seite zu zeigen – es handelte sich um dieselben Ärzte, die mal in die eine, mal die andere Rolle schlüpften. Diejenigen, die einen positiv gestimmten Anästhesisten an ihrer Seite wussten, brauchten nur halb so viele Schmerzmedikamente und konnten 2,6 Tage früher aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Auch der russische Energiefeldforscher Sergej N. Lazarev fand heraus, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Arzt gutherzig ist oder nicht. Mit Gutherzigkeit ist er der Liebe und Gott näher, und das schützt ihn selbst auch davor, Krankheiten seiner Patienten zu übernehmen, was einem gereizten, übelnehmerischen und unzufriedenen Arzt schneller passiert. Solche Ärzte verlieren oft vollkommen das Mitgefühl für ihre Patienten und beginnen dann, unbewusst den Kranken durch ihre Handlungen großen Schaden zuzufügen. „In Amerika berichtete man mir von einem Geistlichen, der Chirurg geworden war. Wenn er vor und während der Operation in Gedanken betete, war das Ergebnis viel besser als ohne Gebet. Das bedeutet, vom inneren Zustand des Chirurgen und sogar des Therapeuten, der Tabletten verordnet, hängt wesentlich die Besserung des Zustands des Kranken ab.“2
Der todsichere Weg, sich krank zu machen
Genauso wie also allein der Geist den Körper heilen kann, so gibt es auch den gegenteiligen Effekt: Wir werden krank, wenn wir uns geistig auf Krankheiten fokussieren. Auf diesem Gebiet forschte Dr. Rankin ebenfalls. In einer Studie an Medizinstudenten gaben 79 Prozent der Befragten zu Protokoll, dass sich bei ihnen die Symptome der Krankheiten zeigen würden, mit denen sie sich während ihres Studiums gerade befassten. Das Syndrom hat sogar einen Namen: Medizinstudentitis.