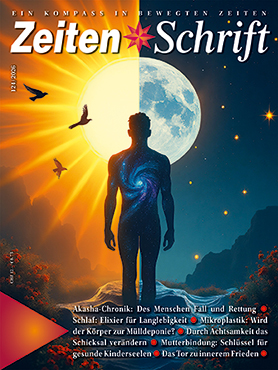Grundeinkommen: Auf nach Utopia!
Die Welt braucht neue Ufer, die sie ansteuern kann, ansonsten droht eine Havarie. Die Digitalisierung wird Millionen von Arbeitsplätzen vernichten. Es ist daher höchste Zeit, dass das „Bedingungslose Grundeinkommen“ ein Menschenrecht wird – genauso, wie es inzwischen auch die Altersrente ist.
„Ohne Arbeitsplatz kein Leben“: Diese Vorstellung hat unsere Köpfe seit 200 Jahren fest im Griff. So glauben wir, dass nur ein Leben mit mindestens 40 Stunden bezahlter Arbeit pro Woche ein lebenswertes sei. Noch lebenswerter, so denken viele, werde das Leben durch seine Anreicherung mit Luxusgütern. Wofür man dann schon eher 50 bis 70 Stunden die Woche arbeiten muss. Die Zeit ist da, sich von dieser fixen Idee zu verabschieden. Denn eine solche Schufterei, wie sie heute als normal angesehen wird, gab es in der Geschichte höchstens beim Einsatz von Sklaven.

Im Mittelalter arbeiteten die meisten Menschen nicht mehr als drei Tage pro Woche in ihrem Beruf: Von Dienstag bis Donnerstag. Und am Freitag hatten sie dann wieder frei, genauso wie am Samstag, Sonntag und Montag. Sowieso war um 1300 das Jahr gespickt mit arbeitsfreien Fest- und Feiertagen; mindestens ein Drittel des Kalenders nahmen sie ein! In Spanien belegten die Feiertage, wo die Arbeit ruhte, gar fünf Monate und in Frankreich das halbe Jahr. In der freien Zeit wurde es den Menschen nicht langweilig: Sonntags ging es zur Kirche (Wochentags meist auch), und die restlichen Tage taten sie, was ihnen richtig oder wichtig erschien: Beispielsweise zum Bau der großen Kirchen und Kathedralen beitragen. Ehrenhalber und gegen Gottes Lohn. Ihr Einkommen aus den drei Arbeitstagen pro Woche reichte, um ihre bescheidenen Bedürfnisse zu erfüllen: Nahrung, ein Dach über dem Kopf, ein bisschen Spiel und Tanz und ein Gläschen Wein oder ein Fässchen Bier. An Kleidern besaß man das Sonntags- und das Werktagsgewand, dessen Hemd auch noch als Schlafrock diente.
Nichts trägt in gleichem Maß wie der Traum dazu bei, die Zukunft zu gestalten. Heute Utopia, morgen Fleisch und Blut.
Victor Hugo (1802–1885)
Die Menschen hatten auch Zeit für ein Mittagsschläfchen unter der Ulme und ein Schwätzchen auf der Bank unter der Linde. Es war ein einfaches Leben ohne unnötigen Schnickschnack. Ein paar Hundert Jahre später, Mitte des 18. Jahrhunderts, begann mit der Industrialisierung die europäische Form der Sklaverei: Nicht nur Männer, auch Frauen und Kinder wurden geschunden. Friedrich Engels berichtete: „In den Kohlen– und Eisenbergwerken arbeiten Kinder von 4, 5, 7 Jahren; die meisten sind indes über 8 Jahre alt. Sie werden gebraucht, um das losgebrochene Material von der Bruchstelle nach dem Pferdeweg oder dem Hauptschacht zu transportieren, und um die Zugtüren, welche die verschiedenen Abteilungen des Bergwerks trennen, bei der Passage von Arbeitern und Material zu öffnen und wieder zu schließen. Zur Beaufsichtigung dieser Türen werden meist kleine Kinder gebraucht, die auf diese Weise 12 Stunden täglich im Dunkeln einsam in einem engen, meist feuchten Gange sitzen müssen, ohne auch nur so viel Arbeit zu haben, als nötig wäre, sie vor der verdummenden, vertierenden Langeweile des Nichtstuns zu schützen. Der Transport der Kohle und des Eisengesteins dagegen ist eine sehr harte Arbeit, da dies Material in ziemlich großen Kufen ohne Räder über den holprigen Boden der Stollen fortgeschleift werden muss, oft über feuchten Lehm oder durch Wasser, oft steile Abhänge hinauf, und durch Gänge, die zuweilen so eng sind, dass die Arbeiter auf Händen und Füßen kriechen müssen. Zu dieser anstrengenden Arbeit werden daher ältere Kinder und heranwachsende Mädchen genommen.“1 Ihre Schicht unter der Erde dauerte zwölf Stunden (sie sahen also im Winterhalbjahr nie Tageslicht), jene der Erwachsenen 14 bis 15 Stunden, sechs Tage die Woche. Doch keine Arbeit hieß Hunger leiden. Auch im Alter. Denn man arbeitete, bis man das Zeitliche segnete.
Und das geschah im Durchschnitt mit 40 Jahren. Die Österreicherin Adelheid Popp, die sich in den letzten Jahren der Monarchie einen Namen als Frauenrechtlerin machte, ehe sie 1919 sozialdemokratische Abgeordnete im Nationalrat wurde, gab Einblick in die Lebensbedingungen in Österreich, wo sie 1869 als fünfzehntes Kind einer Weberfamilie in Inzersdorf bei Wien geboren wurde: Zehn ihrer Geschwister starben früh, und als dann auch noch ihr Vater krank wurde, verschlangen ärztliche Hilfe und Medikamente die ohnehin kargen Einkünfte. „So oft ich mit einem Rezept in die Apotheke geschickt wurde“, schreibt Adelheid Popp, „klagte meine Mutter, wie lange das noch dauern würde“ – Kranksein war mit so großen wirtschaftlichen Opfern verbunden, dass man den Tod des Angehörigen geradezu herbeisehnte.
Als mit Vater Popp dann der einzige Erwerbstätige in der Familie starb, konnte die Mutter ihre fünf überlebenden Kinder nicht mehr ernähren; es gab damals ja keinerlei Pensionsanspruch. Also mussten Adelheid und ihre Geschwister arbeiten gehen. Das Mädchen war noch keine zehn Jahre alt, als es seine ersten Dienste als Hausgehilfin, Näherin und Fabrikarbeiterin antrat, weshalb es die Schule abbrechen musste. Die Mutter hatte keine andere Wahl, als die gesetzliche Schulpflicht ihrer Kinder zu missachten und dafür von Zeit zu Zeit für mehrere Stunden in den Arrest zu gehen. Das Schicksal der Familie Popp ist kein Einzelfall. Kranksein und Altwerden waren im 19. Jahrhundert für viele Menschen mit Betteln und Hausieren verbunden. Eine altersbedingte Pensionierung existierte nirgends, und jene Menschen, die ein höheres Alter erreichten, arbeiteten buchstäblich bis zum Umfallen.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo (1802–1885)
Wer nicht mehr arbeitsfähig war, wurde „ins Ausgedinge“ geschickt, womit man auf die Unterstützung seiner Kinder angewiesen war – diese waren gesetzlich verpflichtet, ihre bedürftigen Eltern zu versorgen. Hatte man keine Kinder oder waren sie nicht in der Lage zu helfen, fiel man der öffentlichen Armenpflege anheim. Während die Großfamilie im ländlichen Bereich relativ gut für ihre Alten sorgte, führte das fehlende Sozialnetz in den Städten im Zeitalter der Industrialisierung zu unvorstellbarer Hungers–und Wohnungsnot, zu Massenausspeisungen und Elendsquartieren.
Die Geburt der Altersrente
Vor gerade mal 131 Jahren, nämlich 1889, schlägt die Geburtsstunde für eine Altersversorgung sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland. Davor gab es einfach nichts. Otto von Bismarck war es, der das Gesetz zur Alters- und Invaliditätssicherung im Mai 1889 durchbrachte. Jeder Arbeiter zahlte nun 1,7 Prozent seines Verdiensts in die neue gesetzliche Rentenversicherung ein. Auszahlungen gab es jedoch erst nach dreißig Jahren des Einzahlens, und das Rentenalter begann mit 70 – bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 40 Jahren. Unter Kaiser Wilhelm II. wurde 1916 das Rentenalter auf 65 Jahre gesenkt. Und erst vor 63 Jahren trat 1957 in Deutschland das heutige Rentensystem in Kraft, wo die jüngeren Arbeitnehmer die Rente der Alten bezahlen; zuvor war das angesparte Kapital für die Höhe der Ruhestandsbezüge entscheidend gewesen.
In Österreich hatten einzig die Beamten der Donaumonarchie einen Anspruch auf eine Alterspension, weshalb sich jeder darum riss, Beamter zu werden, selbst bei jahrelangen Wartezeiten und niedrigen Löhnen. Als 1914 endlich ein Gesetzesentwurf für eine Invaliditäts- und Altersrente im Parlament eingereicht wurde, brach der Erste Weltkrieg aus. Ausgerechnet der Anschluss an Hitlerdeutschland brachte dann Österreichs Arbeiterschaft erstmals die Altersrente. Und das nicht, weil die Nazis so sozial gewesen wären, sondern weil die Rente eben auf Kanzler Bismarck zurückging. Erst in der „Zweiten Republik“, also nach dem 2. Weltkrieg, kam es in Österreich zum vollen sozialen Schutz im heutigen Sinne.
Weshalb schreiben wir all dies? Um zu zeigen, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts eine Altersversorgung entstand, die auf einem Solidaritätspakt besteht: Nicht nur das selbst einbezahlte Geld steht einem später zur Verfügung; nein, die Rente läuft, solange der Mensch lebt und wird von den aktiv Arbeitenden erbracht. Der Gedanke, man könnte ältere Menschen erneut unterstützungslos ihrem Schicksal überlassen, ist undenkbar geworden, barbarisch und vorsintflutlich. Dabei sind die modernen Rentensysteme in den deutschsprachigen Ländern wie erwähnt gerade mal 131 Jahre alt.
Roboter statt Arbeiter
Zurück also zur heutigen Zeit. Manche sagen, „Corona“ diene vor allem dazu, die längst geplante Digitalisierung der Wirtschaft im Eiltempo zu vollziehen. Die Pandemie und die darauffolgende Rezession liefere das vorgeschobene Motiv dazu und breche den Widerstand in der Bevölkerung. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat schon mehrfach verkündet, wozu die „Corona“-Finanzhilfe in den Empfängerländern verwendet werden soll: zur digitalen Aufrüstung und damit Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Nationen. Die Wirtschaft der Zukunft wird ihre Gewinne ohne viel menschlichen Arbeitseinsatz erzielen.
Was fängt man dann mit den Millionen von Menschen an, die plötzlich arbeitslos werden, aber nicht an irgendeinem neuen Virus sterben?
Arbeitslosigkeit bedeutet Abhängigkeit vom kontrollierenden Gängelband des Staats. Es bedeutet soziale Ächtung. Und das nährt Gefühle von Minderwert und Sinnlosigkeit bis hin zur Depression. Es bedeutet erhöhte Suchtgefahr, weil man all diese Gefühle betäuben möchte. Es bedeutet letztendlich, dass der Mensch dazu neigt, sich „nach unten“ zu entwickeln. Weniger zu werden, als er ist, und noch viel weniger, als er sein könnte.
Quellenangaben
- 1 Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Barmen 1845.