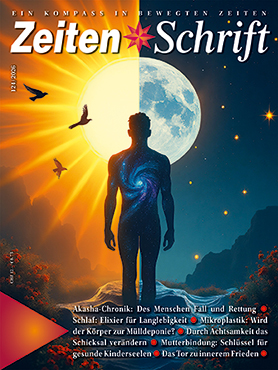Homo Oeconomicus: Die große Cyberschlacht um die Welt
In den letzten fünfzig Jahren bahnte sich eine infernalische Liaison an: Die Vermählung immer schnellerer Computersysteme mit einer Philosophie, welche den Menschen als ein gieriges Tier sieht, das stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Beide zusammen dienen heutzutage dazu, den wenigen Mächtigen immer höhere Milliardengewinne zu bescheren – und alle vernetzten Menschen zu Marionetten ihrer käuflichen Vorlieben zu machen.
Erinnern Sie sich noch an den Film A Beautiful Mind? Er war mit vier Auszeichnungen einer der beiden großen Gewinner der Oscarverleihung 2002, darunter bester Film des Jahres. Russell Crowe spielte den amerikanischen Mathematiker John Forbes Nash Jr., der im Auftrag der US-Regierung Codes sowjetischer Agenten entschlüsselte und als der wohl einflussreichste Vertreter der Spieltheorie gilt. Für diesen „Spieltrieb“ wurde Nash 1994 sogar mit dem Ökonomie-Nobelpreis ausgezeichnet. Das Filmportrait ist herzerweichend emotional, doch so richtig versteht der Zuschauer nicht, was nun eigentlich genau die herausragende akademische Leistung des John Nash war, welche die höchste akademische Auszeichnung rechtfertigt.

Maschine gegen Maschine: Seit einigen Jahren führen lernfähige Algorithmen und Computer an den internationalen Finanzmärkten selbstständig einen Vernichtungskrieg gegeneinander. Transformer Death Blow © Alon Chou / cgwallpapers.com
Es ist mit sein Verdienst, dass Hochleistungscomputer heute in der Lage sind, die Welt viel schneller zu ruinieren, als wir dies mit unserem Verstand zu fassen vermögen. Der jeder Moral spottende Wahnsinn auf den internationalen Finanzmärkten entsprang letztlich einem kranken Gehirn, das nicht gerade einem „schönen, bewundernswerten Geist“ gehört, wie dies der amerikanische Filmtitel suggeriert. A Beautiful Mind kam denn auch mit dem Untertitel Genie und Wahnsinn in die deutschen Kinos. Ein Zahlengenie ist der 1928 geborene Nash zweifellos. Schon als er seine bahnbrechende Entdeckung machte, litt er aber an einer schizophrenen Psychose, die ihn jahrzehntelang quälte. Er musste deswegen sogar in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert werden.
John Nash glaubte fest, dass der Mensch nichts weiter sei als ein grundsätzlich eigennütziges Tier, das rücksichtslos seine egoistischen Ziele verfolgt. Ein pervertiertes Menschenbild, das in den letzten fünfzig Jahren das Handeln der Menschheit immer stärker dominiert hat. Nashs Jugend war geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Als junger Mann und Mathematiker im weißen Kittel war er im Auftrag des Militärs Teil eines Zermürbungskampfs gegen die bösen Russen gewesen. Sein ganzes Denken und Trachten war darauf ausgerichtet, schlauer zu sein als ein Gegner, den Nash nicht sah und mit dem er nicht kommunizieren konnte.
Wenn der Teufel Poker spielt
Seit beide Supermächte über Atombomben verfügten, galt der strategische Leitsatz, hinter allem stets das Schlimmste zu vermuten. Die Logik des Kalten Krieges glich einem Pokerspiel: Jeder versucht, den Gegner zu besiegen; und dazu ist jeder Bluff, jede Lüge recht. Doch der Einsatz war um vieles höher als bloß einige Dollarmünzen. Es ging darum, einen nuklearen Erstschlag des Feindes zu verhindern, ohne selbst auf den roten Knopf drücken zu müssen. Das nannte sich dann „Gleichgewicht der gegenseitigen Abschreckung“. In diesem Poker um Atomraketen waren die strategischen Schachzüge dieselben wie beim Kartenspiel. Rational – also vernünftig – zu sein hieß, dass jeder nur an sich selbst denkt. Eben dies war schon seit Längerem auch das Credo der Ökonomen. Und so machte sich der junge Zahlenzauberer John Nash daran, eine Formel zu finden, welche genau das möglich machen würde: das künftige Verhalten eines Menschen mathematisch zu berechnen.
Weil aber der Mensch im Grunde genommen viel zu komplex und vielschichtig ist, als dass man ihn in eine mathematische Gleichung zwängen könnte, musste sein Wesen – zumindest in der Theorie – schablonenhaft vereinfacht werden. Also besann sich Nash auf die Behauptung der Ökonomen und beschloss, allem menschlichen Verhalten Eigennutz zu unterstellen. Und siehe da: Als Mitarbeiter der Rand Corporationgelang es dem erst 22-jährigen John Nash, jene berühmte Gleichung zu formulieren, die seither als „Nash-Equilibrium“ oder „Nash-Gleichgewicht“ bekannt ist.
Das war 1950, die Sternstunde der Spieltheorie. Ein harmloser Name für ein alles andere als harmloses Forschungsfeld. Spieltheoretiker wie John Nash sind keineswegs verspielte Naturen, die gerne knifflige Denksportaufgaben oder Brettspiele für die ganze Familie entwerfen. Sie versuchten und versuchen immer noch, den blanken Egoismus mit Mathematik zu untermauern und ihm dadurch den Anschein eines Naturgesetzes zu verleihen. Bei diesen Gedankenspielen geht es um knallharten Überlebenskampf. Was dabei herauskam, war der US-Regierung so wichtig, dass diese Papiere seit 1953 als militärische Geheimnisse galten und in Panzerschränken weggeschlossen wurden.
Rückblickend schrieb der amerikanische Journalist Fred Kaplan: „Die Spieltheorie behauptete, dass es unvernünftiges Verhalten sei, über seinen Schatten zu springen, also das zu tun, was für beide Seiten das Beste ist, und darauf zu vertrauen, dass der Gegner dasselbe tut. In diesem Sinn war die Spieltheorie die perfekte intellektuelle Grundlage für den Kalten Krieg.“ In den Köpfen der Spieltheoretiker (und mittlerweile auch zu vieler Wirtschaftsbosse und Politiker) ist Verrat am anderen, um auf dessen Kosten einen Vorteil zu erringen, die vernünftigste Verhaltensweise – und deshalb normal.
Mitten im Kalten Krieg hatte John Nash eine Theorie „nicht kooperativer“ Spiele entworfen. Gemeint sind Spiele, in denen man mit dem Spielpartner nicht kommunizieren kann, ihm nicht traut und in denen beide Gegner versuchen, die Absichten des Opponenten herauszufinden. Hierbei gilt der Grundsatz, dass die wahrscheinlichsten – also vernünftigsten oder rationalsten – Spielzüge des anderen immer die eigennützigsten sind. Die Essenz dieser Theorie der rationalen Entscheidung – im Englischen Rational Choice Theory genannt – ist also ganz einfach: Man muss sich in den Egoismus des anderen hineinversetzen, um seinen eigenen Egoismus besser ausspielen zu können. Wenn dies beide Parteien tun, wird auf diese Weise eine Art Gleichgewicht hergestellt (beispielsweise die gegenseitige Abschreckung im Kalten Krieg). Dieses Gleichgewicht ist das berühmte Nash-Equilibrium.
Mit seiner mathematischen Formel goss John Nash die Geisteshaltung der Kalten Krieger in eine wissenschaftlich anerkannte Form. Ein Denken, das darin gipfelte, dem Gegner die totale Vernichtung anzudrohen. Leider blieb der Einflussbereich des Nash-Gleichgewichts nicht bloß auf Kriegsspiele beschränkt. „Die Mathematiker haben ein perfektes narrensicheres System entdeckt“, so jubelte John McDonald, der Anfang der Fünfzigerjahre als erster Reporter in die hochgeheimen Studierstuben der Spieltheoretiker vorgelassen wurde, „mit dem man alle Arten halsabschneiderischer Spiele spielen kann: von Poker über das Business – bis hin zum Krieg.“
Nun, später sollte sich in den globalen Finanzkrisen zeigen, dass dieses System doch nicht so „perfekt und narrensicher“ war, wie man die Welt hatte glauben machen wollen. Trotzdem betrachtet man John Nashs Gleichung bis heute als „nichts anderes als die mathematische Weltformel für konsequenten und erfolgreichen Egoismus“, wie FAZ-Mitherausgeber Frank Schirrmacher in seinem Bestseller EGO – Das Spiel des Lebensschreibt.
Damit setzten der spätere Nobelpreisträger Nash und seine Forscherkollegen eine Entwicklung mit fatalen Konsequenzen in Gang. Während die Gesellschaft rücksichtslos selbstsüchtiges Verhalten von vor einem halben Jahrhundert noch immer als einen verachtenswerten Mangel an Moral betrachtete, erklärte die Wissenschaft diesen Egoismus plötzlich zum gesunden und natürlichen Fundament allen Strebens.
Zu dem Zeitpunkt, als Nash seine Theorie formulierte, konnte außer einigen wenigen anderen Zahlengenies kaum jemand etwas mit dieser Formel anfangen; sie hatte keinen praktischen Wert, von den Strategien des Kalten Kriegs einmal abgesehen. Und so kam auch niemand auf die Idee, Nash deswegen für den Nobelpreis vorzuschlagen. Vorerst.
Doch mit dem Aufkommen der ersten Computer – wie immer verfügte das Militär zuerst über die neue Technologie – sollte sich dies dramatisch ändern. Und heute, im Zeitalter des Internets, in welchem fast alle Privathaushalte dank Heimcomputer miteinander vernetzt sind, beeinflusst der im Nash-Gleichgewicht festgeschriebene Egoismus unser ganzes Leben. Als mathematische Formel ist diese Gleichung kompliziert, „aber man muss sie nicht lernen“, so der Publizist Schirrmacher. „Sie findet sich heute in Börsenalgorithmen von Hedgefonds, in Auktionsplattformen, in den mächtigsten Werbealgorithmen der Welt (bspw. Google AdWords) und vermutlich auch in sozialen Netzwerken. Sie ist der große Ego-Automat im Herzen unserer Systeme.“
Computer sind so gute Rechner, dass sie mit der Gleichung von John Nash problemlos klarkommen. Und weil ihr Code inzwischen fast überall hineinprogrammiert wurde, bedeutet dies auch, dass wir gelernt haben, nach den Regeln des Egoismus zu spielen. Wer nicht rücksichtslos seine Ellbogen einsetzt, den bestraft das Leben. So lautet die Botschaft eines Weltbildes, das viele kleine (und große) Egoisten hervorbringt, weil es hinter allem menschlichen Tun die unausweichliche Logik des Eigennutzes am Werk sieht.
Genauso wie die Lehre vom schrankenlosen Egoismus unsere Seele vergiftet, zerstört der Mobilfunk die biologische Harmonie in unseren Zellen. Das eine erzeugt Krebs auf geistiger Ebene, das andere im Körper. Es mag daher mehr sein als Zufall, dass die spieltheoretische Formel von John Nash erstmals im großen Stil bei der Versteigerung von Telekommunikationsfrequenzen zum Einsatz kam. Das war in den Neunzigerjahren und brachte allein der US-Regierung Milliarden ein. Sowohl Staat als auch Bieter hatten sich dabei von Spieltheorie-Experten unter der Berücksichtigung des Nash-Gleichgewichts beraten lassen. Großbritannien ließ die Auktion der G3-Mobilfunklizenzen im Jahr 2000 ebenfalls nach den egoistischen Regeln der Spieltheorie organisieren. Der Profit lag bei unvorstellbaren 22 Milliarden Pfund. Diese unrealistischen Einnahmen schienen der endgültige Beweis für die Richtigkeit des Nash-Gleichgewichts zu sein.
Quants erobern die Wall Street
Gleichzeitig wurde die neue mathematische Wunderwaffe auch von der Hochfinanz eingekauft. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Kriegs waren nämlich gerade in den USA viele Mathematiker und Physiker arbeitslos geworden, weil ihre Dienste nicht länger in Militärkreisen benötigt wurden. Also packten sie ihre Koffer und bewarben sich an der Wall Street, wo man sie mit offenen Armen willkommen hieß. Denn damals, in den frühen Neunzigern, waren die Computer bereits dabei, massenhaft die Welt zu erobern. Doch die Fondsmanager der Wall Street hatten kaum Ahnung davon, wie sich dieses neue Werkzeug möglichst gewinnbringend in der Börsenspekulation einsetzen ließ. Die Investmentbank Goldman Sachs – sowieso schon aufs Engste mit den politischen Schaltstellen der Macht verflochten – war das erste Finanzinstitut, welches diese sogenannten „Quants“ im großen Stil anheuerte. Sie programmierten die Computer mit spieltheoretischen Algorithmen, die den Börsenhandel extrem beschleunigten und eine völlig neue Art von komplexen Finanzprodukten möglich machten, die nicht einmal mehr die Banker selbst verstanden. So zog der Kalte Krieg mit seinen „Angriffen“, „Kills“ und „Massakern“ nicht bloß verbal ins Finanzbusiness ein, wo seither virtuelle „Monster“ aus den „Frankenstein’schen Laboren an der Wall Street“ (so der US-Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz) Volkswirtschaften ganz real zerstören.
Im großen EGO-Spiel des Lebens ist sich eben jeder selbst der Nächste. Jetzt, wo die Investmenthäuser Gewinne einfahren konnten wie nie zuvor, war die Zeit endlich reif, jenem Mann zu danken, dessen Formel dies überhaupt erst möglich gemacht hatte. Und so wurde John Forbes Nash Jr. 1994 mit dem Nobelpreis der Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet – für eine mathematische Gleichung, die er bereits vierundvierzig Jahre zuvor niedergeschrieben hatte.
Die virtuelle Welt der Computer öffnete ein ebenso virtuelles Geld-Universum, in dem sich grenzenlos Profit scheffeln lässt. Das Einzige, was dem „rationalen Eigennutz“ der Hochfinanz noch im Weg stand, waren die Schranken des Gesetzes. Doch dem half US-Präsident Bill Clinton ab. Der Illuminat1 deregulierte den Finanzmarkt zwischen 1994 und 1999 in mehreren Schritten und befreite die Bankenlandschaft von einschränkenden Leitplanken. Zuletzt schaffte Clinton die gesetzliche Trennung zwischen Geschäfts- und Investment-Banken ab, die nach der großen Depression in den 30er-Jahren zum Schutz des Finanzsystems eingeführt worden war. Sein Nachfolger, der Illuminat George W. Bush, öffnete die Büchse der Pandora schließlich vollends, als man den Investmentbanken im Jahr 2004 erlaubte, ihre Geschäfte unbegrenzt auf Pump zu finanzieren. Damit war der letzte gesetzliche Riegel gefallen, der die Menschen noch halbwegs vor dem gierigen Wahnsinn der Hochfinanz geschützt hatte. Nur drei Jahre später schlitterte die Welt bereits in die bis heute andauernde Finanzkrise ab.
Handeln wie der Blitz
Genauso wie sich die Spirale des Gewinnens (oder Verlierens!) an den Börsen in schwindelerregender Weise dreht, sprengt auch die Leistungsfähigkeit modernster Computer jegliches menschliche Fassungsvermögen. Wer glaubt, die wichtigen Entscheidungen würden noch immer da fallen, wo sich Börsenhändler im Ring anschreien, ist im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Heute liegt die wahre Macht bei jenen Elektronen, die in Lichtgeschwindigkeit über Computerplatinen flitzen. Allein an der New Yorker Börse werden jede Minute fünf Millionen Aktien gehandelt. Kein Mensch kann da den Überblick behalten. Der Computer aber schon. „Innerhalb von vier Jahren hat sich in den USA die durchschnittliche Aktien-Haltefrist von zwei Monaten auf zweiundzwanzig Sekunden reduziert“, schreibt Frank Schirrmacher. In den Fünfzigerjahren betrug sie übrigens noch durchschnittlich vier Jahre.
Beim sogenannten „Hochfrequenzhandel“ ist jegliche menschliche Dimension längst über Bord gekippt worden. In seinem aktuellen Bestseller erklärt Schirrmacher, was man sich unter diesem nüchternen Begriff vorzustellen hat: „Finanzmarkttransaktionen nähern sich mittlerweile der Lichtgeschwindigkeit an. Trader installieren ihre Server direkt neben den Computern der New Yorker Börse, um Millisekunden zu schinden. Ein eigens verlegtes transatlantisches Kabel wird die Übermittlungszeit von Daten zwischen der Wall Street und den Londoner Tradern um 740 Nanosekunden reduzieren (1 Nanosekunde ist eine Millionstel Millisekunde). Übersetzt in unser normales Zeitgefühl besteht der Unterschied darin, ob man eine Entscheidung in einer Minute oder in knapp zehn Wochen treffen muss. Die Falle schnappt millionenfach schneller zu, als irgendein menschliches Wesen auch nur imstande wäre zu begreifen, dass es in einer Falle sitzt.“
Einer, der diese Systeme baut, doppelt nach: „Wenn der normale Kunde einen Aktienkurs sieht, ist es so, als schaue er auf einen Stern, der in Wahrheit schon seit Jahrtausenden erloschen ist.“
Mit anderen Worten: Händler aus Fleisch und Blut sind im Hochfrequenzhandel nicht mehr zu gebrauchen. 2008 hatte der hinter vorgehaltener Hand als „Darth Vader“ bezeichnete Boss von Lehman Brothersseinen Mitarbeitern denn auch erklärt, alles, was man für den grenzenlosen Profit brauche, sei „die Macht der Maschine“. Doch das bewahrte Joseph M. Gregory trotzdem nicht davor, wenige Monate später seinen Job los zu sein. Die Investmentbank ging bekanntlich am 15. September 2008 wegen der Immobilien- und Finanzkrise Pleite.
Quellenangaben
- 1 Einen Enthüllungsreport über die heimliche Dominanz der Illuminaten finden Sie in der ZS 64.