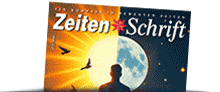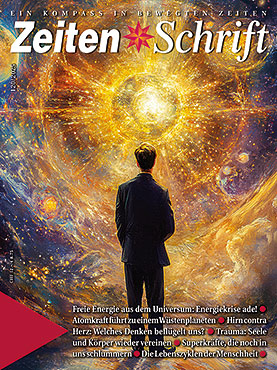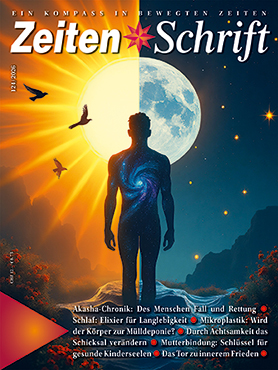Verhütung: Im Einklang mit dem Körper
Sie gilt als Goldstandard der Verhütung, doch immer mehr Frauen wollen nichts (mehr) von ihr wissen: die Antibabypille. Die Geschichte der „Pille“ liest sich wie ein Krimi. Denn im Interesse der Frau ist das kleine weiße Ding ganz sicher nicht.

Vor dem künstlichen Licht folgte der Körper der Frau oft dem Mond: Bei Vollmond war Eisprung, bei Neumond kam die Periode.
Als am 18. August 1960 in den USA mit Enovid die allererste Antibabypille auf den Markt kam, empfanden das viele Frauen als Befreiungsschlag. Endlich Sicherheit vor ungewollter Schwangerschaft, endlich die eigene Sexualität selber in die Hand nehmen können, endlich Erlösung von dem Damoklesschwert, unverheiratet ein Kind gebären und die damit verbundene soziale Ächtung ertragen zu müssen. Zwar galt „die Pille“ noch als anrüchig und war vor allem der Kirche ein Dorn im Auge. Deshalb wurde sie zunächst nur an verheiratete Frauen abgegeben. Trotzdem war der Siegeszug der Pille nicht mehr aufzuhalten. – Das heißt, bis vor wenigen Jahren. Denn die jungen Frauen von heute sind pillenmüde. Verhüteten beispielsweise in der Schweiz 1992 noch 52 Prozent der Frauen mit der Pille, waren es 2022 noch 31 Prozent. Ihnen wurden damals 1,66 Millionen Packungen der Antibabypille verkauft, was den Herstellern einen Umsatz von 45,39 Millionen Franken bescherte. Auch in Deutschland haben die Frauen keinen Bock mehr auf die Pille. 2023 ließ sich nur noch jede vierte der Frauen unter 22 Jahren die Pille verschreiben. Drei Jahre zuvor war es noch jede Dritte gewesen. Trotzdem bleibt die Pille über alle Altersklassen hinweg gesehen das beliebteste Verhütungsmittel und wird nach wie vor von Millionen Frauen täglich geschluckt. Doch was ist passiert, dass immer mehr Frauen den „Befreiungsschlag“ ihrer Großmütter und Mütter als „Old School“ betrachten und der heutige Befreiungsschlag der ist, die Pille abzusetzen oder gar nicht erst damit anzufangen?
Wer sich in die Entstehungsgeschichte der Antibabypille vertieft, stellt schnell fest, dass es dabei um alles Mögliche ging, ganz sicher aber nie um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Frau. Nur wenige wissen beispielsweise, unter welch schrecklichen Bedingungen die Grundlagenforschung zur Antibabypille entstanden ist. Diese stammte vom deutschen Gynäkologen Carl Clauberg, der seine Medizinversuche in Block 10 des Konzentrationslagers Auschwitz durchführte!
Wirklich Fahrt nahm die Sache dann aber in den USA mit der Entwicklung von synthetischen Hormonen auf. Bereits in den späten 1930er-Jahren hatte man dort das erste synthetische Östrogenpräparat Diethylstilbestrol (DES) entwickelt. Weil es die Wirkung des körpereigenen Östrogens hemmt, wurde es zur Behandlung von Fehl- und Frühgeburten verwendet. Doch bald fand man noch einen viel breiteren Verwendungszweck. War die Menopause bis zu diesem Zeitpunkt ein natürlicher Teil des Lebens jeder Frau gewesen, machte man daraus nun eine Krankheit, die behandelt werden musste. Frauen über fünfzig hätten nämlich ihren Zenit und damit ihre Nützlichkeit und Attraktivität überschritten, hieß es nun. Mit der Einnahme von DES in der Menopause könnten sie sich revitalisieren und ihre Jugendlichkeit, Attraktivität, Energie und ihre Lust auf Sex wiedergewinnen. Und so verschrieb man bis in die Siebzigerjahre DES an Millionen von Frauen. Bis man endlich feststellte, dass es krebserregend war, bei Föten zu Missbildungen der Genitalien führte und die Tumoranfälligkeit sogar auf nachfolgende Generationen weitergegeben werden konnte, wenn DES während der Schwangerschaft geschluckt worden war. DES gilt übrigens als erster endokriner Disruptor, denn seine chemische Zusammensetzung zeigt eine verblüffende Ähnlichkeit zum in Verruf geratenen Bisphenol-A (BPA) in Plastik. Ein interessanter und wohl durchaus beabsichtigter Nebeneffekt des Hormonersatztherapiemittels DES war, dass der Anteil arbeitender Mütter plötzlich massiv anstieg. In den USA vervierfachte sich diese Zahl allein zwischen 1940 und 1960.
Ungefähr zur gleichen Zeit forschte man an Verhütungsmitteln auf der Basis von Progesteron, wobei man zunächst mit Wirkstoffen aus der mexikanischen Yams- Pflanze experimentierte. 1951 gelang es dem Pharmaunternehmen Syntex S.A. (heute Roche), das erste synthetische Progesteron, Norethindron, zu entwickeln. Nur wenige Monate später zog das Konkurrenzunternehmen G.D. Searle (heute Pfizer) mit seinem eigenen künstlichen Progesteron namens Norethynodrel nach. Von der Entwicklung der Pille war man aber noch ein paar Jahre entfernt und man wusste bereits, dass die Nebenwirkungen heftig sein könnten.
Kampf für oder gegen die Frau?
Es war ausgerechnet eine Frau, die maßgeblich dafür verantwortlich war, dass es die Pille überhaupt gibt. Die 1879 geborene Margaret Sanger hatte gute Gründe, sich für eine Verhütungspille einzusetzen. Als Krankenschwester erlebte sie unzählige Male, was fünfzehn Schwangerschaften (damals durchaus eine übliche Zahl) für die Frauen bedeutete, und sie sah viele verzweifelte Frauen, die deshalb selbst mit barbarischen Methoden versuchten, eine unerwünschte Schwangerschaft zu beenden, oder dafür jemanden aufsuchten, der eine illegale Abtreibung vornahm. Auch hier wurde meist gepfuscht, viele Frauen starben, andere litten danach ein Leben lang Schmerzen und waren verstümmelt.
Sanger war durchaus eine mutige und entschlossene Frau, denn zu dieser Zeit war es verboten, den Frauen Informationen über Verhütung oder gar Verhütungsmittel zu geben. Weil Sanger aber genau dies immer wieder tat, etwa durch Publikationen, die Eröffnung einer illegalen Klinik oder indem sie aus Holland das verbotene Diaphragma in die USA einschmuggelte, wurde sie mehrfach verhaftet und sah sich immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Auch als sie in den 1940er-Jahren begann, sich vehement für Frauenrechte einzusetzen, fand sie nur wenig Unterstützung. Diese wurde ihr erst gewährt, als sie sich mit stärkeren – und dunkleren – Kräften zusammentat.
Margaret Sanger ist keineswegs unumstritten, denn sie befürwortete Zwangssterilisationen und bewegte sich im Kreis der Unterstützer einer Rassenhygiene und von Eugenikern. Als sie in diesen Dunstkreisen auf die Rockefeller- und Carnegie-Familien traf, war der Weg zur Pille geebnet, denn nun begannen Millionen in die 1942 von ihr gegründete Organisation Planned Parenthood („Geplante Elternschaft“) zu fließen. Vor allem unter der Ägide von John D. Rockefeller III entstand eine enge Zusammenarbeit. Dieser hatte 1952 eine Organisation namens Population Council gegründet, welche das Bevölkerungswachstum über die Geburtenkontrolle steuern und kontrollieren sollte. Unterstützt und finanziert von weiteren „Philanthropen“ arbeiteten das Population Council und Planned Parenthood zusammen an der Entwicklung von neuen Verhütungsmethoden, wobei das Gedankengut des Feminismus, der Geburtenkontrolle, Bevölkerungskontrolle und Eugenik nahtlos miteinander verschmolzen wurden.
Unterstützt von der wohlhabenden amerikanischen Frauenrechtlerin Katharine Dexter McCormick trat Margaret Sanger 1953 an einen gesellschaftlich in Ungnade gefallenen Forscher heran, dem die Öffentlichkeit den Beinamen „Dr. Frankenstein“ verpasst hatte. 1934 hatte der erst 31-jährige Dr. Gregory Goodwin Pincus, Sohn von russisch-jüdischen Einwanderern, Bekanntheit erlangt, als ihm eine In-vitro-Befruchtung bei Kaninchen gelungen war. Dummerweise war kurz zuvor das Buch Brave New World von Aldous Huxley erschienen, und die Öffentlichkeit glaubte in Pincus’ Forschung eben jene apokalyptische Welt, die im Buch beschrieben wurde, heraufziehen zu sehen. Statt mit Geld und Ruhm überhäuft wurde Pincus geschmäht und konnte sich und seine Familie mehr schlecht als recht über Wasser halten. Das änderte sich allerdings, als Sanger und McCormick in sein Leben traten. Der Vorteil von Pincus war, dass Syntex und Searle ja bereits künstliche Progesterone herstellen konnten. Es ging nun also einfach darum, daraus ein orales Verhütungsmittel zu kreieren. Mit dem Geld von McCormick konnte Pincus innerhalb weniger Monate anhand von Tierexperimenten beweisen, dass Progesteron tatsächlich als Verhütungsmittel taugte. Nebenbei gesagt forschte man bereits damals auch an bioidentischen Hormonen, die in verschiedenen Pflanzen vorkommen. Weil diese nicht patentierbar waren und deshalb auch keinen Profit versprachen, wurde dieser Ansatz aber bald fallen gelassen.